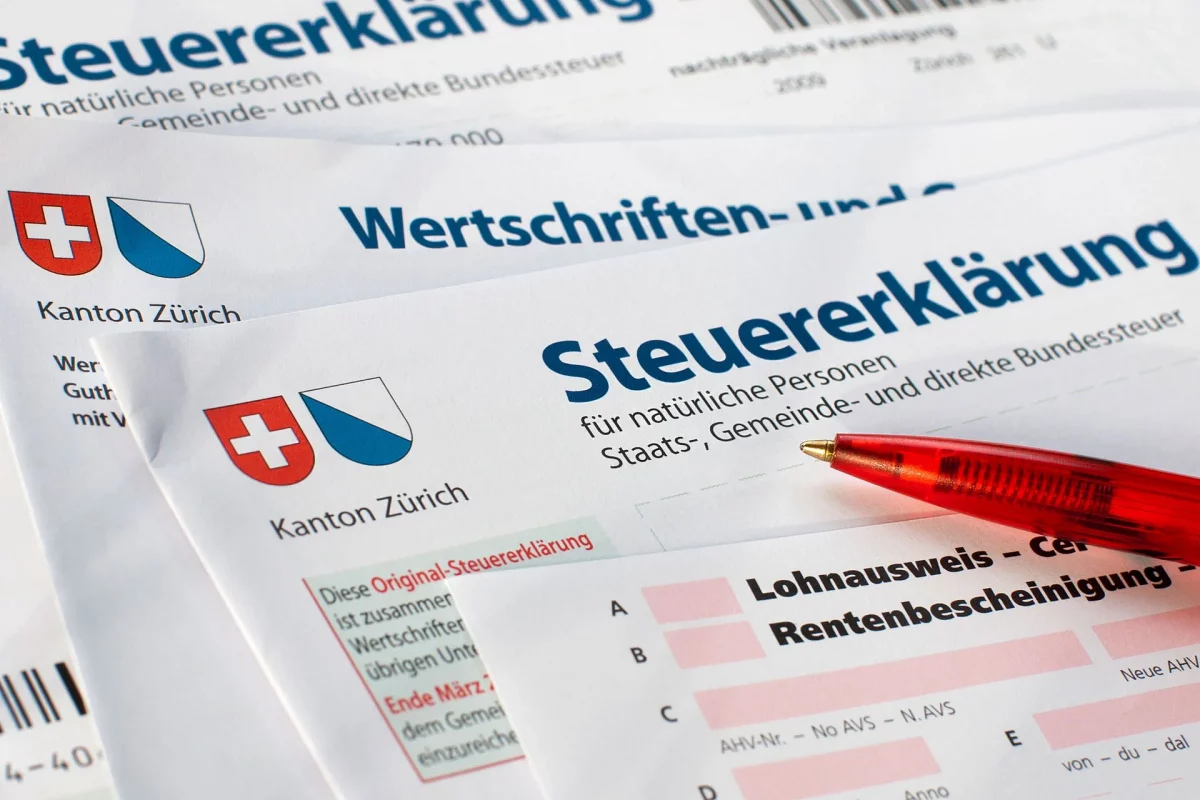Die Kritik an den Löhnen der On-Gründer ist kleinlich: Wer als Unternehmer reich wird, ist kein Abzocker Bald zehn Jahre nach Annahme der «Abzocker»-Initiative provozieren hohe Vergütungen immer noch reflexartige Kritik aus Politik und Medien. Diese ist nicht immer gerechtfertigt, wie der Fall des Sportschuhherstellers On zeigt.
Bald zehn Jahre nach Annahme der «Abzocker»-Initiative provozieren hohe Vergütungen immer noch reflexartige Kritik aus Politik und Medien. Diese ist nicht immer gerechtfertigt, wie der Fall des Sportschuhherstellers On zeigt.

Roger Federer ist der Inbegriff der Schweizer Bodenständigkeit. Er wirkt nahbar und sympathisch, bei Platzinterviews macht sich der Tennis-Superstar auch einmal über sich selbst lustig. Ähnlich ist es – oder war es – beim Schweizer Schuhhersteller On, bei dem Federer sich seit einigen Jahren als Investor engagiert.
Die Unternehmensgründer erzählen in Interviews gerne, dass man als Angestellter in den Zürcher Büros auch einmal barfuss und verschwitzt direkt vom Sport an eine Sitzung gehen dürfe. Statt einen gewöhnlichen CEO hat On zwei Co-CEO: Sie seien partnerschaftlich organisiert, betonen die Gründer, die Verantwortung sei auf viele Schultern verteilt. Auch das wirkt bescheiden.
Doch die Bodenständigkeit ist in beiden Fällen, bei Federer und bei On, eine Illusion.
Die Bodenständigkeit ist nur vermeintlich
Der 20-fache Grand-Slam-Sieger hat sportlich und finanziell höchst erfolgreiche Jahre hinter sich. Allein das gewonnene Preisgeld beläuft sich auf 130 Millionen Dollar. Natürlich lebt Federer mit seiner Familie nicht in einem kleinen Reiheneinfamilienhaus im Baselbiet. Er besitzt ein grosses Chalet in Valbella, hat einen Wohnsitz in Dubai, fliegt Privatjet und hat vor kurzem für geschätzte 40 bis 50 Millionen Franken in Rapperswil ein grosses Grundstück mit Seeanstoss gekauft. Seinem Image hat das erstaunlicherweise kaum geschadet.
Die On-Gründer wiederum haben ihr 2010 gegründetes Unternehmen im vergangenen September in New York an die Börse gebracht und sind dabei reich geworden, sehr reich sogar. Im Zuge des Börsengangs haben sich die drei Gründer und die zwei Co-CEO zusätzlich zum Marktwert ihrer bestehenden Aktienpakete (Hunderte Millionen Franken) und zum Verkauf eines Teils ihrer Aktien (Dutzende Millionen Franken) pro Kopf je einen Fixlohn (225 000 Franken), einen Bonus (130 000 Franken) und eine aktienbasierte Entlohnung (13,5 Millionen Franken) ausbedungen.
Doch während man dem Sympathieträger und On-Investor Federer seine Extravaganzen gerne nachsieht, stehen die On-Gründer in der öffentlichen Gunst seit dem Börsengang in New York mittlerweile weniger gut da.
Nach der Veröffentlichung des Vergütungsberichts, der diesen Frühling einen Pro-Kopf-Lohn von 16,5 Millionen Franken zutage förderte, wurden Vergleiche zu den Löhnen der Chefs von Pharmakonzernen, Grossbanken und den Platzhirschen Nike und Adidas gezogen. Die Rede war von «dreisten Wahnsinnslöhnen», die Präsidentin der Jungsozialisten sprach von «Affront gegenüber der Belegschaft».
Das zeigt exemplarisch, dass sich die Debatte um Kaderlöhne bald zehn Jahre nach Annahme der «Abzocker»-Initiative im Jahr 2013 noch kaum weiter entwickelt hat und dass man in der Schweiz im Umgang mit unternehmerischem Erfolg teilweise immer noch kleinlich ist.
Wer viel riskiert, soll dafür auch belohnt werden
Natürlich sind 16,5 Millionen Franken pro Geschäftsleitungsmitglied ein enormer Betrag in einem Jahr, in dem das Unternehmen zwar seinen Umsatz um 70 Prozent gesteigert hat, in der Erfolgsrechnung aber einen Verlust ausweist. Und ebenso reflexartig erfolgt angesichts solcher Vergütungen die Kritik aus Politik und Medien.
Tatsache ist aber: Wer auf eigenes Risiko ein Unternehmen gründet, sollte in Sachen Vergütung nicht mit einem festangestellten CEO verglichen werden, der nach einigen Jahren im Unternehmen sein Lager abbricht und zum nächsten Arbeitgeber weiterzieht.
Man darf auch nicht vergessen, dass On im Schweizer Startup-Universum im positiven Sinn einen Ausreisser darstellt. Als die Gründer 2010 ihre ersten Laufschuhe auf den Markt brachten, waren sie wie die meisten Startup-Unternehmer noch Lichtjahre davon entfernt, ihr Unternehmen an die New Yorker Börse zu bringen.
Sie investierten ihre Zeit und ihr Geld in einen gesättigten Markt, in dem der Raum für Innovationen klein schien und die Marketing-Budgets der etablierten Player dafür umso grösser waren. Der in den sechziger Jahren gegründete Marktführer Nike erzielte zu dem Zeitpunkt mit Schuhen bereits einen Umsatz von über zehn Milliarden Dollar, Adidas (Gründungsjahr: 1949) lag bei sieben Milliarden.
Die Markteintrittsbarrieren für On waren also beträchtlich, und das Wagnis hätte gut und gerne mit einem Konkurs enden können. Die Marke On wäre wie Tausende neugegründete Schweizer Firmen nach einigen Jahren wieder vom Markt verschwunden, und die Gründer hätten ihr Investment abschreiben müssen.
Stattdessen entwickelte sich aus dem Projekt, den «Laufschuh für das perfekte Laufgefühl» zu entwickeln, eine globale Sportartikelmarke. Deren Gründer haben sich in den Kopf gesetzt, dass On künftig zu den grossen Playern gehört. Ob das gelingt, ist unklar, es gibt unter Analytikern auch skeptische Stimmen, die auf andere Unternehmen aus dem Sportartikelsegment zeigen, die die hohen Erwartungen nie erfüllen konnten. Immerhin steigerte On 2021 seinen Umsatz um 70 Prozent auf über 700 Millionen Franken. Für dieses Jahr strebt das Unternehmen einen Umsatz von knapp einer Milliarde Franken an.
Die Geschichte von On zeigt: Es ist wichtig, dass Unternehmer sich von der Aussicht darauf, reich zu werden, motivieren lassen, Höchstleistungen zu erbringen. Die Schweizer Volkswirtschaft braucht Menschen, die sich aus der Komfortzone eines festen Arbeitsverhältnisses mit geregelten Arbeitszeiten wagen und versuchen, eine risikoreiche Geschäftsidee Realität werden zu lassen.
Allerdings muss der Nährboden dafür stimmen, dass Unternehmer das Risiko der Selbständigkeit wagen. Weniger Regulierung, Steuervorteile, Coaching-Angebote für Gründerinnen und Preise für Jungunternehmen sind wichtige Instrumente der Startup-Förderung.
Wer als Unternehmer reich wird, soll sich aber auch nicht schämen müssen und nicht als «Abzocker» abgestempelt werden. Der allenthalben kleinliche Umgang in der kleinen Eidgenossenschaft mit unternehmerischem Erfolg schadet dem Wirtschaftsstandort, und das besonders in Zeiten, in denen das Land im internationalen Standortwettbewerb – Stichwort globale Mindeststeuer – zunehmend unter Druck gerät.
Aktienbasierte Vergütungen setzen langfristige Anreize
Der Grossteil der Vergütungen für die On-Gründer und Co-CEO wird zudem nicht in Cash ausbezahlt, es handelt sich um Vergütungen in Form von Aktien beziehungsweise Optionen («share-based compensation»), deren Übertragung an Bedingungen geknüpft ist. Zudem erfolgen sie zeitlich verzögert über mehrere Jahre.
Mit einem hohen Aktienanteil am eigenen Lohn nehmen die Kader in Kauf, dass ihr persönliches Vermögen ähnlich wie bei einem Startup stark mit dem Erfolg des Unternehmens korreliert. Wenn der Kurs steigt, werden sie auf dem Papier reicher. Wenn der Kurs der Aktien mit dem Tickersymbol Onon fällt, sinkt auch das Privatvermögen der Inhaber automatisch.
Genau das ist seit Anfang Jahr eingetreten: Der Kurs der On-Aktien ist – auch aufgrund des schwierigen geldpolitischen Umfelds und der hohen Anfangsbewertung – um die Hälfte eingebrochen. Es versteht sich von selbst, dass es weitaus einfacher wäre, sich einen höheren Fixlohn direkt auf das Bankkonto auszahlen zu lassen.
Mehr Tiefe in der Debatte
Der Unmut über hohe Managerlöhne wird so schnell nicht abebben. Selbst Finanzminister Ueli Maurer stellte bei der Behandlung eines Vorstosses im Nationalrat zur Boni-Thematik vor vier Jahren etwas ernüchtert fest: «Ein CEO einer Grossbank verdient in einem Jahr gleich viel wie der Bundesrat, alle sieben Mitglieder zusammen, in einer ganzen Legislatur. Da sehen Sie, wie günstig Ihr Bundesrat arbeitet.»
Unrecht hat Maurer nicht. Zwar hat die «Abzocker»-Initiative die Mitspracherechte der Aktionäre gestärkt und zwingt die Unternehmensführungen, Rechenschaft über die ausbezahlten Löhne abzugeben. Die Bestimmungen im Artikel 95 der Bundesverfassung haben aber nicht, wie viele der Initiativbefürworter wohl gehofft hatten, zu einer Reduktion der CEO-Vergütungen bei kotierten Gesellschaften geführt – im Gegenteil.
Die Saläre von Topmanagern sind eher noch gestiegen, wie neueste Daten zeigen. Die Chefs der 30 Unternehmen mit den liquidesten und grössten Schweizer Aktien haben im vergangenen Jahr laut einer Analyse der Nachrichtenagentur AWP im Durchschnitt fünf Prozent mehr als im Vorjahr verdient.
Zuoberst auf der Liste steht der CEO des Pharmakonzerns Roche, Severin Schwan, mit 15 Millionen Franken. An zweiter und dritter Stelle kommen der UBS-Chef Ralph Hamers (11,5 Millionen) und der Novartis-CEO Vasant Narasimhan (11,2 Millionen). Der durchschnittliche Lohnanstieg bei den Topmanagern wäre noch höher ausgefallen, wenn nicht Thomas Gottstein, Chef der Grossbank Credit Suisse, im Zuge verschiedener bankinterner Krisen einen Lohnabschlag von 56 Prozent verzeichnet hätte.
Man könnte diese Liste noch beliebig verlängern, aber zielführend ist das nicht. Es ist an der Zeit, dass man in der öffentlichen Diskussion über Managerlöhne die Frage ins Zentrum rückt, welche Art von Vergütungen den Firmenchefs die richtigen, das heisst, langfristigen Anreize setzen, um im Sinn des Unternehmens zu handeln. Und welche Art von Vergütungen kurzfristige Fehlanreize setzen, die man vermeiden sollte. Aktien- und optionsbasierte Lösungen bieten viele, wenn auch keine perfekten Möglichkeiten, um die Interessen des Managements an den Interessen der Aktionäre auszurichten.
Im Fall des Laufschuhherstellers On wird sich an der Generalversammlung in zwei Wochen weisen, ob die Aktionäre die umfangreiche Besoldung der Geschäftsleitung goutieren – oder ob sich die drei Gründer auf ihre bodenständigen Wurzeln zurückbesinnen müssen.