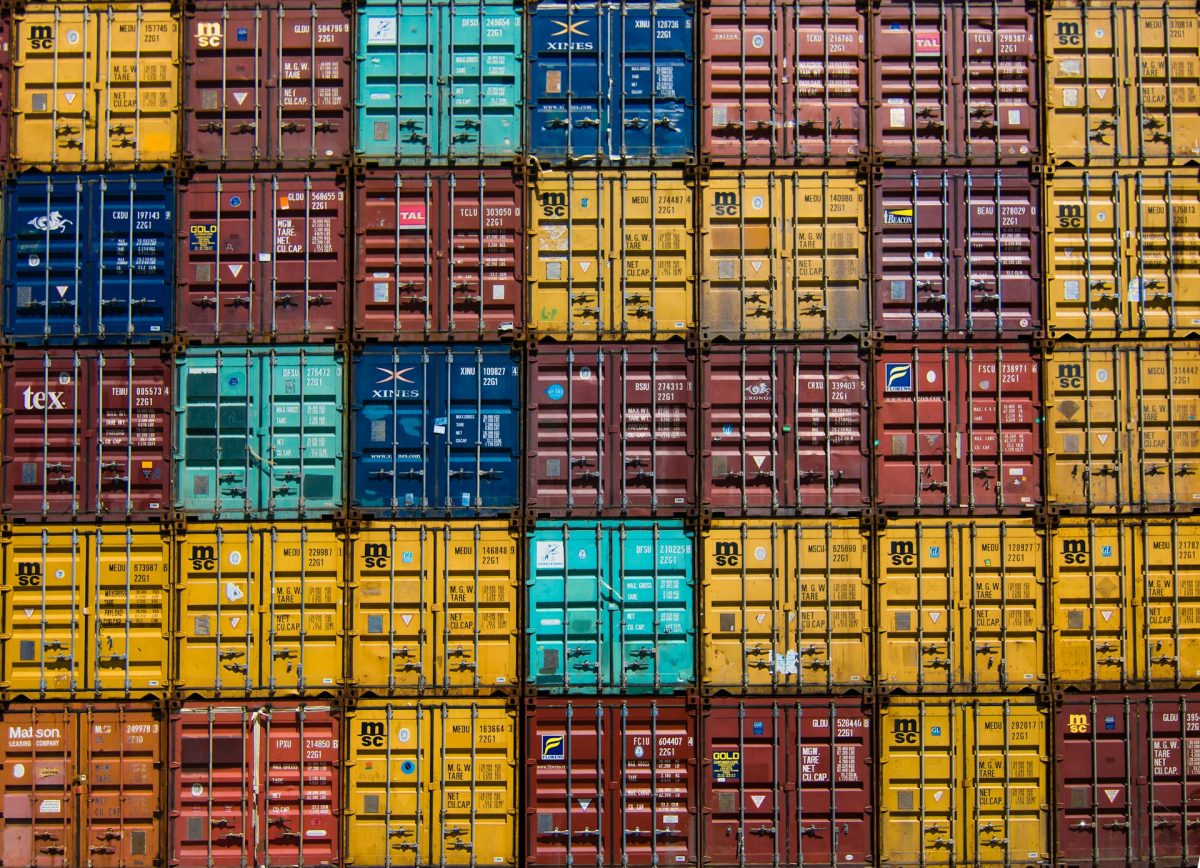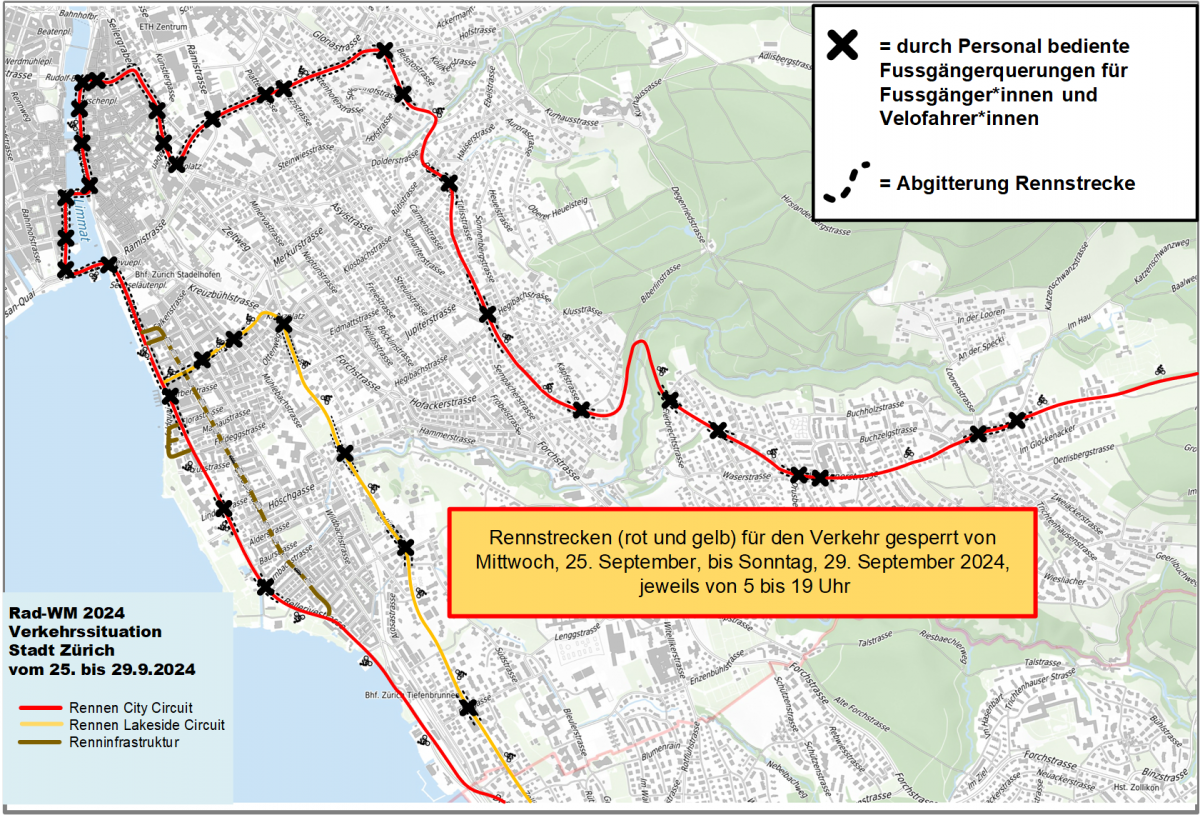Der Päckli-Boom verändert die Post – von der Briefträgerin bis zum Logistikzentrum «Endlich habe ich etwas in der Hand!» Unterwegs auf der Post-Tour der Zukunft im Zürcher Unterland.
«Endlich habe ich etwas in der Hand!» Unterwegs auf der Post-Tour der Zukunft im Zürcher Unterland.

Nadja Rychtarowa hatte schon Angst, arbeitslos zu werden. Das war vor einigen Jahren, als die Briefe immer weniger wurden.
«In manche Häuser brachte ich nur noch Werbung», sagt sie, während sie das Magazin «Landliebe» in den Briefschlitz eines Einfamilienhauses in Neerach im Zürcher Unterland schiebt. «Jetzt mit den Paketen ist das anders. Endlich habe ich wieder etwas Rechtes in der Hand!»
Dann nimmt sie ein Päckli unter dem Arm hervor, scannt es mit ihrem Smartphone und legt es in den Milchkasten. «Es passt perfekt hinein», sagt sie. «Das freut mich immer.»
Rychtarowa ist 54 Jahre alt, Pöstlerin und trug bis vor kurzem nur Briefe aus. Mit dem Päckli-Boom hat sich ihre Arbeit verändert. In ihrem Verteilgebiet schleppen Briefträger auch Pakete bis vor die Türe. Das zusätzliche Gewicht spüre man schon, sagt sie. «Wir haben alle etwas abgespeckt.»
Die Post der Zukunft
Aber Rychtarowa ist zufrieden: Mit den Paketen habe sie wieder mehr als genug Arbeit. Jede Woche gehe sie trainieren, sagt sie, um fit zu bleiben – um diesen Job bis zur Pensionierung machen zu können. Um weiter täglich von fünf Uhr früh bis Nachmittags um drei Uhr schwer bepackt durch das Zürcher Unterland zu tingeln.
Das Unterland: Das sind an diesem Tag misstrauische Blicke aus eingehagten Gärten, joggende Rentner und Einfamilienhäuser, so weit das Auge reicht. Neerach, Stadel, Glattfelden: Die Gemeinden auf Rychtarowas Route tragen heimelige Namen. Und sie sehen nicht wie Orte aus, an denen sich Revolutionen irgendwelcher Art ereignen.
Und doch erprobt die Post genau hier, von ihrem regionalen Stützpunkt in Glattfelden aus, das Verteilsystem der Zukunft: Briefe und Pakete zusammen, in neuen Fahrzeugen, mit neuem Sortiersystem – und mit dem alten Personal.
«Es war eine Umstellung, klar», sagt Rychtarowa. Sie hat jetzt mehr Ware, trägt schwerere Lasten und fährt mehr unterschiedliche Routen. «Aber die Abwechslung gefällt mir.» Als alleinerziehende Mutter sei sie zudem auf einen sicheren Job angewiesen. Vom Lohn könnten sie und ihre zwei Töchter gut leben.
«Während der Shutdowns, als Lastwagen um Lastwagen mit Päcklein kamen, da war es schon anstrengend. Aber ich war einfach froh, arbeiten zu können.»
Weniger Briefe, mehr Pakete
Rychtarowa kam 2012 aus ihrem Heimatland Tschechien in die Schweiz. Eigentlich ist sie gelernte Hochbauzeichnerin, doch in diesem Bereich fand sie keine Stelle. 2015 startete sie bei der Post als Briefträgerin – erst Teilzeit mit drei Nebenjobs, dann Vollzeit. Sie ist damit eine Quereinsteigerin, wie sie die Post angesichts steigenden Personalbedarfs immer mehr braucht.
Weniger Briefe, mehr Pakete: Das ist seit Jahren der Trend, auch wenn die Briefe das Geschäft immer noch dominieren. Rund 200 Millionen Pakete hat die Post vergangenes Jahr ausgeliefert. Immer mehr davon sind Priority-Sendungen. In einem Tag ans Ziel: Das galt vor zwanzig Jahren für jedes fünfte Paket. Heute gilt es für jedes zweite.
Um sich dem Wandel anzupassen, ändert sich die Arbeit der Pöstlerinnen nicht nur im Kleinen. Auch im Grossen baut die Post kräftig um.
In Rümlang zum Beispiel, zwanzig Minuten Autofahrt von Glattfelden entfernt. Dort wurde am Freitag ein neues Paketzentrum eröffnet, nach nur einem Jahr Bauzeit. Kosten: 11 Millionen Franken. Rund siebzig Mitarbeitende sortieren hier nun 5000 Pakete pro Stunde – auch jene, die danach durch Nadja Rychtarowas Hände gehen.
Damit spart sich die Post einen Zwischenschritt bei der Verteilung. Zwölf solcher regionaler Paketzentren baut sie in der ganzen Schweiz. Das Ziel: Effizienz, Effizienz, Effizienz.
In der Halle des neuen Zentrums versammeln sich am Freitag bei der Eröffnung zwei Männer und zwei Frauen rund um einen gelben Knopf: Vertreterinnen und Vertreter der Post sowie die Regierungsrätin Carmen Walker Späh (FDP). Sie zählen auf drei und drücken die Hände nach unten. Ein Piep-Ton erklingt, dann erfüllt ein hohes Summen die Halle.
Die Rollbänder beginnen zu laufen.
Fortan spulen sie hier die ganze Nacht Kilometer ab. Von 16 Uhr bis 5 Uhr früh werden in zwei Schichten die Pakete sortiert, die in Zürichs Norden aufgegeben werden. Die Halle entspricht modernstem Standard, dennoch dürfte das Arbeitsumfeld kein einfaches sein: konstanter Lärm, Kunstlicht, Lagerhallenluft. Viele hier arbeiten Teilzeit, sagt Irma Schnyder, die Leiterin des Zentrums.
Mensch und Maschine müssen sich aneinander gewöhnen
An einem der Förderbänder steht ein Mann mittleren Alters. Er trägt Handschuhe und hebt Pakete von einem Rollgestell. Bis zu dreissig Kilogramm schwer dürfen sie sein – es ist die Grenze der zugelassenen Belastung. Die Pakete durchlaufen eine Schleuse, die elektronisch Adresse, Grösse und Gewicht erfasst. Automatisch werden sie dann auf das richtige Rollband verteilt.
Noch läuft die Anlage nicht auf Hochtouren. Mensch und Maschine müssen sich noch aufeinander einspielen. Es braucht beides, damit das System funktioniert.
Die Zürcher Regierungsrätin Carmen Walker Späh lobt in ihrer Grussbotschaft die Post dafür, dass diese das Zentrum nicht auf der grünen Wiese gebaut, sondern eine bestehende Infrastruktur übernommen habe. Das neue Paketzentrum sei zudem wichtig für die Region Zürich Nord.
Eine historische Wende
Die Regionalisierung der Paketverteilung ist eine Trendwende: Ab Mitte des 20. Jahrhunderts ging der Trend jahrzehntelang in Richtung zentralisierter Verteilung an immer weniger Standorten.
Noch bis in die 1990er Jahre passierte in den Logistikzentren der Post zudem vieles von Hand. Erst danach setzte die Automatisierung voll ein. Maschinen übernahmen die Sortierung, Software die Überwachung der Mitarbeitenden. Die Post wurde umgebaut. Und wie die immer mehr auf Effizienz getrimmte Arbeit drinnen ist auch jene der Pöstlerinnen draussen heute eine andere als früher.
Jedes Haus, jede Adresse und jeden bissigen Hund kennen: Das müssen Pöstler immer weniger. Bei Nadja Rychtarowa im Zürcher Unterland ist das Smartphone das wichtigste Arbeitsinstrument. Damit scannt sie jedes Paket. Darauf erfährt sie, wo die Kunden es abgelegt haben wollen. Dort sieht sie, ob sie eine Lieferung vergessen hat.
Auch bei der Beladung des Fahrzeugs hilft ein digitales System. Es scannt bei jedem Paket die Adresse und benennt die dazugehörige Tour – und den passendsten Platz im Post-Wägelchen.
Die Arbeit der Post-Angestellten wird damit einfacher – aber die Mitarbeitenden werden auch leichter ersetzbar. Im Stützpunkt Glattfelden wurden eben erst zwei Aushilfskräfte für die Paketsortierung eingestellt. «Diese Arbeit kann eigentlich jeder machen», sagt die Vizechefin des Verteilzentrums.
Das ist auch eine Sorge der Post-Gewerkschaft Syndicom: dass künftig qualifizierte Mitarbeitende durch schlechter bezahlte temporäre Arbeitskräfte abgelöst werden könnten – oder dass die Post Arbeit gleich ganz an Private auslagert, wo der Druck höher und der Lohn tiefer ist.
Mehr Druck auf Angestellte
Der Syndicom-Regionalleiter Dominik Dietrich sagt, die Arbeit der Pöstler werde auch in Zukunft anspruchsvoll bleiben. In Sortierzentren sei der Anteil temporärer Arbeitskräfte jedoch während der Pandemie gestiegen. «Wir erwarten, dass diese Leute nicht ewig als Manövriermasse gebraucht, sondern nach spätestens einem Jahr angestellt werden.»
Auf genau das haben sich Gewerkschaften und Post allerdings schon während der Pandemie geeinigt, bei den Verhandlungen zum Gesamtarbeitsvertrag von 2021. Und auch sonst ist Syndicom eigentlich recht zufrieden damit, wie die Post den Päckli-Boom angeht.
Die gemischte Zustellung von Briefen und Paketen, die neuen regionalen Verteilzentren, der Stellenausbau: Das sei alles positiv, sagt der Gewerkschafter Dietrich, gerade angesichts der starken Belastung in den letzten Jahren. Nur die Löhne der Angestellten dürften nicht auf der Strecke bleiben. Die sind zwar im Schnitt deutlich höher als bei privaten Lieferdiensten. Bei Neuangestellten – vor allem bei Jungen und Frauen – sind sie laut Syndicom jedoch eher tief.
Auch der Lohndruck durch Private sei ein Problem für die Post und die Pöstler. Anders als beim Bundesbetrieb gibt es bei der privaten Konkurrenz nämlich keinen Gesamtarbeitsvertrag.
Was sagt die private Konkurrenz?
Die Schweizer Post ist im Paketbereich unbestritten führend mit einem Marktanteil von über 80 Prozent. Die Mitbewerber sind DHL und DPD, jeweils in Besitz der deutschen beziehungsweise der französischen Post. Seit einigen Jahren versucht sich auch die Firma Planzer aus dem Limmattal in diesem Markt – «als einziges nichtstaatliches Unternehmen», wie der Planzer-Chef Nils Planzer betont.
Planzer investiert ins Paketgeschäft, weil das Unternehmen dort von weiterhin starkem Wachstum ausgeht. Die Post werde an Grenzen stossen, es habe Platz für weitere Marktteilnehmer.
Die starke Position der Post sei im internationalen Vergleich schon aussergewöhnlich, sagt Planzer. Dennoch findet er wohlwollende Worte für seine grosse Konkurrentin. Diese arbeite professionell und gehe gut mit ihren Mitarbeitenden um. Der milliardenteure Ausbau sei zwingend, damit das Staatsunternehmen «das Volumen sauber abbildet», also dem Päckli-Boom gerecht werden kann.
Gesichtserkennung und Anti-Stress-Schuhe
Die Arbeit der privaten Paketlieferanten und die der Pöstlerinnen bleiben dabei sehr verschieden. Die Post ist für viele auch eine emotionale Angelegenheit.
Das spürt man auch auf der Tour mit der Briefträgerin Nadja Rychtarowa. Der kurze Schwatz mit (meist älteren) Kunden gehört dort dazu. Dafür bleibe trotz Mehrarbeit fast immer Zeit, versichert sie. Die ebenfalls anwesende Post-Mediensprecherin nickt zustimmend.
Dann wird es Zeit, dass Rychtarowa weitermacht. Für die Fotografin stellt sie sich ein letztes Mal hin. Ihre Stirn ist schweissnass, die Anti-Stress-Schuhe an ihren Füssen sind ausgelatscht. Abgerutschte Pakete haben kleine Narben an ihren Beinen hinterlassen.
Doch sie sieht glücklich aus, wie sie danach mit dem nächsten Paket vor das nächste Einfamilienhaus geht. Sie hält ihr Smartphone in die Höhe, scannt das Päckli und schaut dann in die Kamera. Per Gesichtserkennung muss sie die Lieferung bestätigen.
Suchend dreht sie die Kamera und den Kopf, bis das Gerät ihr Gesicht erkennt. Dann legt sie das Päcklein in den Milchkasten.
Es passt perfekt hinein.