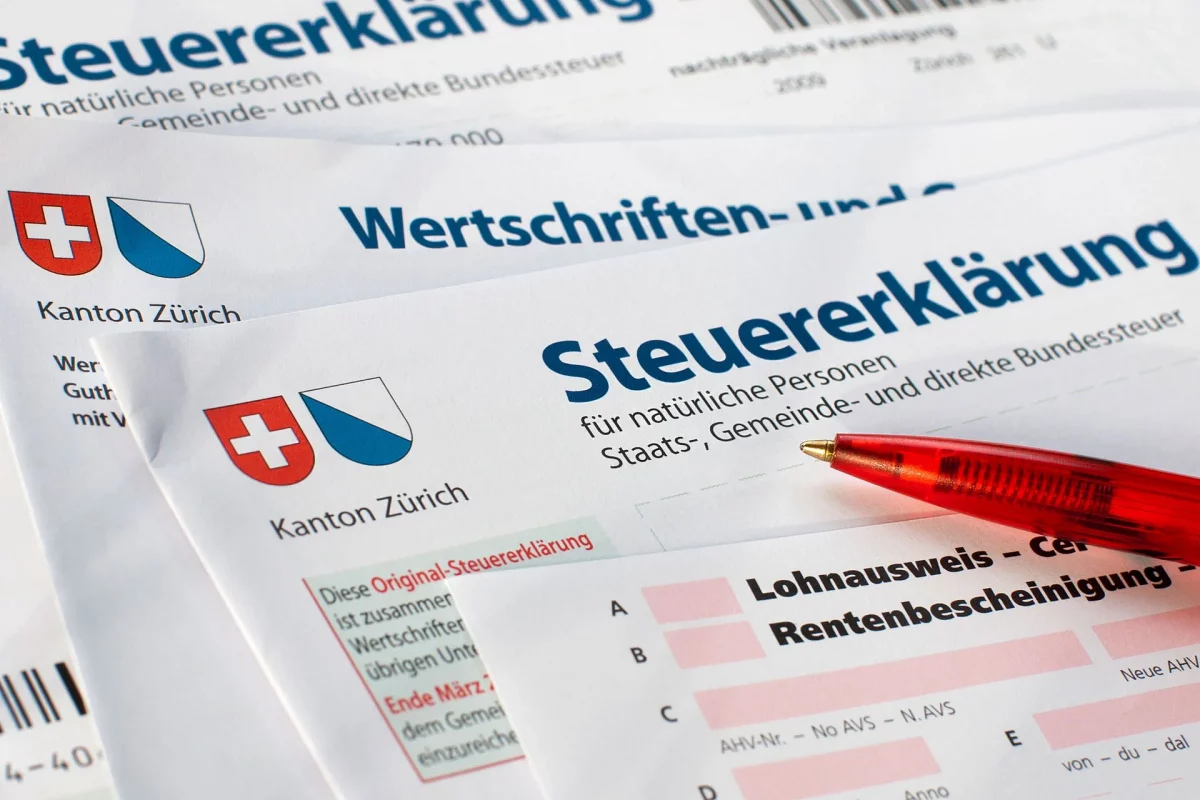5, 10 oder 20 Prozent? Die amerikanische Trinkgeld-Kultur erreicht die Schweiz Wer mit Karte bezahlt, wird neuerdings zum Trinkgeld geben aufgefordert.
Wer mit Karte bezahlt, wird neuerdings zum Trinkgeld geben aufgefordert.

Die rechte Hand hält den Kaffee, die linke das Brötchen, irgendwo dazwischen schiebt man die Karte ans Lesegerät. Dann leuchten da: 5, 10, 20 Prozent – wie viel Trinkgeld darf es denn sein? Gibt man nichts, ist man ein Geizhals, gibt man zu viel, ein Narr. Der Mensch tendiert zur Mitte, also drückt man ergeben die 10 Prozent.
Trinkgeld per Touchscreen, so sieht das aus in der neuen Welt der Gastronomie. Wer in Restaurants und Cafés bargeldlos bezahlt, den fragen die Kartenlesegeräte immer häufiger nach einem Trinkgeld. Auch Take-aways und Selbstbedienungslokale fordern neuerdings ungehemmt zum Trinkgeldgeben auf. Auswählen lassen sich meist Prozentbeträge, auch die Option «Kein Trinkgeld» gibt es; in kleiner Schrift am unteren Rand des Bildschirms, gemacht, um übersehen zu werden.
Das Geben von Trinkgeld war lange Zeit ein informeller Vertrag zwischen Kellner und Gast. In diese Beziehung hat sich nun ein Gerät geschoben. Anstatt unserem Gegenüber ins Gesicht zu schauen, starren wir auf ein blinkendes Display. Und der Gast hat nicht mehr zu entscheiden, ob er ein Trinkgeld geben will, sondern höchstens noch: Wie viel?
Der «Nudging»-Effekt
Viele Jahre sah es so aus, als würde die bargeldlose Bezahlung das Trinkgeld verdrängen. Es kam anders: Heute ist das Trinkgeld ein Zwischenschritt im digitalen Zahlungsprozess. Die Idee dafür kam den Anbietern von Kartenlesegeräten. Sie witterten ein Geschäft. In der Regel verdienen sie einen festen Anteil an den Zahlungen, die über ein Gerät abgewickelt werden – also verdienen sie auch am Trinkgeld mit.
Wie hoch die Prozentsätze auf einem Gerät sind, entscheidet ein Gastronom selbst. Er kann die Funktion auch abstellen. Ein Mitarbeiter von Lightspeed, einem Anbieter von Kartenlesegeräten, sagt: «Am Anfang sind die meisten Gastronomen zögerlich und setzen die Prozentbeträge bei 3, 5 und 7 an. Geben die Gäste dann Trinkgeld, wächst das Selbstvertrauen, die Beträge zu erhöhen.»
Und wie die Gäste Trinkgeld geben. Dahinter steckt ein Prinzip aus der Verhaltensökonomie: das «Nudging». «Nudging», zu Deutsch Schubsen, beschreibt die Lenkung von Verhalten in eine erwünschte Richtung. Schrittzähler auf dem Handy zum Beispiel sind «Nudges» für mehr Bewegung. Beim digitalen Trinkgeld wirkt das «Nudging» zweifach: Erstens erinnern die Prozentsätze den Gast daran, dass er überhaupt ein Trinkgeld geben kann, zweitens geben sie mit den festgelegten Beträgen auch gleich vor, wie viel Trinkgeld erwartet wird.
10 Prozent zum Beispiel. Was früher als fürstlicher Zustupf galt, ist heute der Durchschnitt. Auch das ist verhaltensökonomisch zu erklären: Wer im Restaurant einen Wein bestellt, wählt weder die teuerste noch die günstigste Flasche, sondern eine dazwischen. Menschen mögen den Kompromiss. Wer nun beim Trinkgeld zwischen 5, 10 und 20 Prozent auswählen kann, drückt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die 10.
«Handgriff verdient kein Trinkgeld»
Warum Menschen ein Trinkgeld geben, wie und wann sie es tun, zu diesen Fragen forscht Marcel Stadelmann. Stadelmann ist Verhaltensökonom an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Er sagt: «Viele Menschen fühlen sich unter Druck, wenn sie direkt nach Trinkgeld gefragt werden. Besonders wenn ihnen andere beim Bezahlen zuschauen, kann es schwierig sein, Nein zu sagen.»
Doch offenbar würden das viele Gäste gerne tun: auch einmal Nein sagen. Laut einer Studie der ZHAW aus dem Jahr 2022 fühlen sich zwei Drittel der Befragten bevormundet, wenn ihnen Prozentsätze fürs Trinkgeld vorgeschlagen werden. Einige sagten, sie würden dadurch dazu gedrängt, mehr Trinkgeld zu geben, als eigentlich gewollt.
Marcel Stadelmann sieht das ähnlich. Gerade bei grösseren Beträgen seien Prozentsätze wenig sinnvoll, sagt er. «Warum sollte ich für eine Weinflasche, die 150 Franken kostet, mehr Trinkgeld geben als für eine Weinflasche, die 50 Franken kostet? Der Service ist derselbe.»
Unverständlich sei für ihn auch, wenn Selbstbedienungslokale nach einem Trinkgeld fragten. «Ein einfacher Handgriff verdient für mich persönlich kein Trinkgeld», sagt Stadelmann.
Keinen Zwanziger für den Arzt
Das Trinkgeld: Nicht erst seit der Digitalisierung ist es eine überaus rätselhafte Sache. Mit ökonomischen Theorien lässt es sich nicht erklären, der Homo oeconomicus würde nie ein Trinkgeld geben. Denn dem Trinkgeld müsste rational betrachtet eine Leistung folgen, man erhofft sich dadurch einen besseren Tisch im Restaurant, einen schnelleren Service, mehr Wein im Glas. Tatsächlich geben wir ein Trinkgeld aber dann, wenn wir den Preis für eine Arbeit oder eine Ware bereits bezahlt haben.
Das Geben von Trinkgeld folgt anderen Gesetzen. Tut uns jemand Gutes, haben wir das Bedürfnis, etwas zurückzugeben. Die Aufmerksamkeit, mit der uns eine Bedienung umsorgt, erwidern wir mit einem Trinkgeld. Wir sagen damit Danke.
Manchmal sagen wir mit dem Trinkgeld auch Entschuldigung. Ein Trinkgeld geben wir Personen, von denen wir ausgehen, dass sie für ihre Leistung zu wenig entlöhnt werden: Der Kellner, der am Wochenende arbeitet, die Putzkraft, die den Dreck der anderen wegräumt. Niemand käme auf die Idee, einem Arzt einen Zwanziger über den Schragen zu schieben.
Selbstbedienung und doch ein schlechtes Gewissen
In der Schweiz wurde das Trinkgeld im Jahr 1974 abgeschafft. Seither gilt «service compris», der Lohn eines Angestellten muss im regulären Preis enthalten sein. Doch manche Gewohnheiten lassen sich nicht per Dekret regeln. Bis heute ist das Aufrunden auf den nächstgrösseren Betrag verbreitet, aber wohlbemerkt freiwillig.
Anders in den USA. Dort ist das Trinkgeldgeben Pflicht, als Standard gelten 20 Prozent. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner leben vom Trinkgeld, weil es der Mindestlohn alleine nicht richten kann – für Jobs mit Trinkgeld liegt er aktuell bei 2,13 Dollar pro Stunde.
Aber auch in Amerika läuft eine Debatte über das Trinkgeld. «Tipflation» heisst der Begriff der Stunde, eine Wortkreation aus dem englischen «Tip» und «Inflation». Viele Betriebe haben mit Verweis auf die Teuerung die Trinkgeldbeträge auf ihren Geräten derart erhöht, dass nun 20, 25, ja sogar 30 Prozent verlangt werden. Das Magazin «New Yorker» hat dem Thema einen langen Essay gewidmet. Darin sprechen Kundinnen und Kunden über den Druck zu «tippen», selbst wenn sie den Salat am Buffet selbst schöpfen und zur Kasse tragen müssen.
Auch dafür gibt es in den USA einen Begriff: «Guilt Tipping». Man gibt Trinkgeld also nicht mehr für den guten Service, sondern weil man ein schlechtes Gewissen hat. Für die Angestellten hat sich das bisher gerechnet. Ihre Chefs haben realisiert, dass sie mehr Trinkgelder einnehmen, je höher die Prozentsätze sind. Laut dem «New Yorker» sind die Trinkgelder in Bäckereien und Cafés in den vergangenen drei Jahren um 41 Prozent gestiegen.
Der Trinkgeld-Forscher Marcel Stadelmann glaubt, dass auch die Schweiz sich dem amerikanischen Modell annähern wird. Mit den Prozentsätzen sei das zum Teil schon geschehen. Doch Trinkgelder in der Höhe von 30 Prozent, wie sie in New York und Los Angeles üblich sind, wird es in Zürich und Basel nicht geben. Dafür sind die Schweizer Mindestlöhne zu hoch. «Wahrscheinlich werden sich die 10 Prozent durchsetzen», sagt Stadelmann.
So oder so werde die Digitalisierung die Trinkgeldkultur in der Schweiz aber grundlegend verändern. Wenn immer mehr Menschen unhinterfragt ein Trinkgeld geben, gehe das wertschätzende Element verloren, sagt Stadelmann. «Dann wird das Geben von Trinkgeld zum Zwang.»