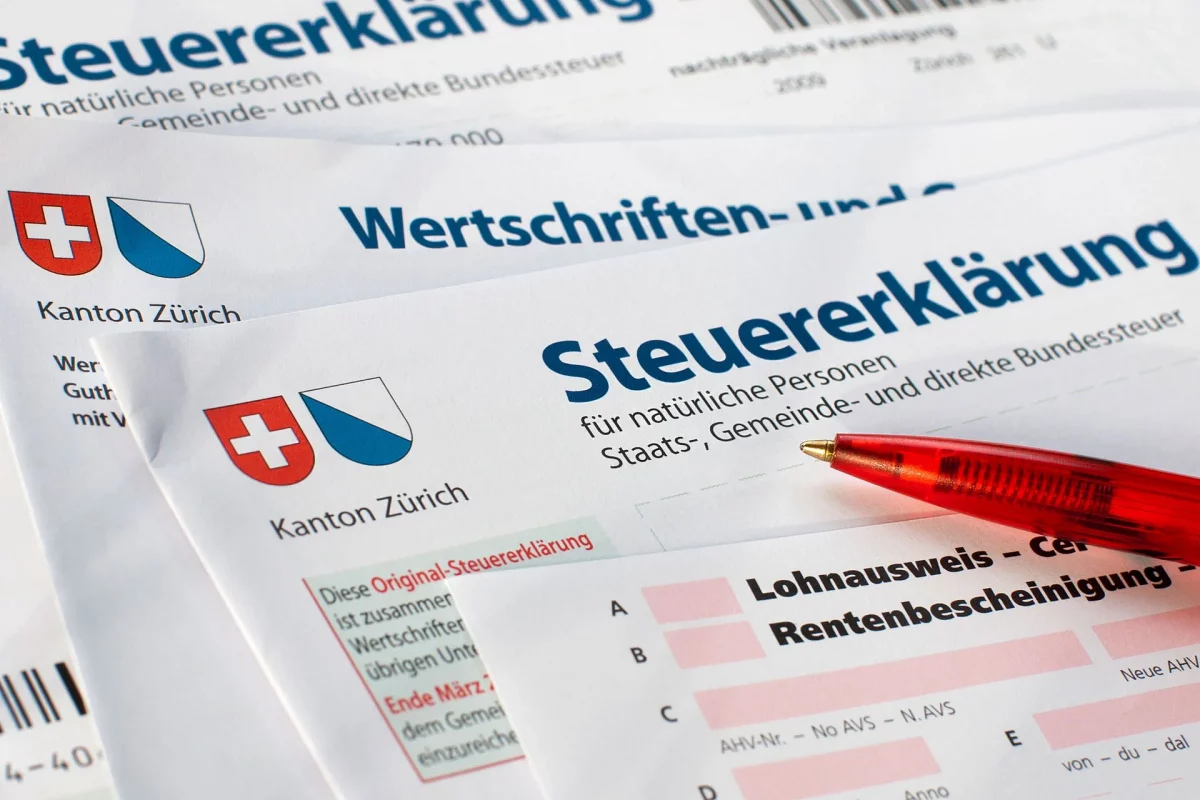Die Lohnunterschiede zwischen Mann und Frau sollte man nicht vorschnell skandalisieren Lohnungleichheit ist ein grosses Politikum. Aber sie ist kleiner, als die meisten denken. Und um eine eigentliche Diskriminierung handelt es sich selten.
Lohnungleichheit ist ein grosses Politikum. Aber sie ist kleiner, als die meisten denken. Und um eine eigentliche Diskriminierung handelt es sich selten.

43 Prozent: Diese Zahl bewegt die Gemüter. Sie entspricht den totalen Erwerbseinkommens-Unterschieden zwischen Männern und Frauen in der Schweiz. Damit steht die Schweiz im internationalen Vergleich ähnlich da wie ihre Nachbarländer Österreich, Deutschland und Italien.
Unsere westlichen Nachbarn in Frankreich liegen mit knapp 30 Prozent merklich darunter. In Dänemark, Portugal und Litauen beträgt der totale Geschlechterunterschied gar nur 20 bis 25 Prozent. Ist es um die Lohngleichheit in der Schweiz also schlecht bestellt? Wie kommen diese Differenzen zustande? Und: Handelt es sich dabei um Diskriminierung? Zur Beantwortung dieser Fragen gilt es die 43 Prozent im Detail zu durchleuchten.
Unterschiedliche Arbeitsstunden – insbesondere bei Müttern
Diese gesamte Lohndifferenz setzt sich aus drei Komponenten zusammen: Unterschiede in der monatlichen Arbeitszeit, variierende Stundenlöhne sowie unterschiedliche Erwerbsbeteiligung von Frauen und Männern.
Dabei vermag die erste Komponente – das unterschiedliche Arbeitspensum – bereits die Hälfte des gesamten Geschlechterunterschieds zu erklären. Tatsächlich liegt die monatliche Arbeitszeit bei Frauen in der Schweiz deutlich unter jener der Männer. Anders beispielsweise als in Portugal und Dänemark, wo beide ähnlich viel arbeiten.
Die meisten Frauen in der Schweiz sind zwar am Arbeitsmarkt beteiligt, arbeiten jedoch in (oftmals niedrigen) Teilzeitpensen, während die grosse Mehrheit der Männer 80 bis 100 Prozent arbeitet. Diese Unterschiede ergeben sich vorwiegend im Zusammenhang mit der Familiengründung.
Die Schweiz weist bis heute einen deutlichen «motherhood paygap» auf – also einen Lohnunterschied infolge Mutterschaft. Frauen verdienen auch fünf Jahre nach der Geburt ihres ersten Kindes im Durchschnitt 60 Prozent weniger als vor der Geburt. Vergleicht man hingegen die Lohnentwicklung lediger Männer und Frauen, zeigen sich entsprechend kaum Differenzen.
Was lässt sich daraus schliessen? Lohnunterschiede sind gerade bei Familien auch Ausdruck gelebter Familien- und Rollenbilder. Den Entscheid über die Aufteilung von Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung sollte jede Familie individuell treffen. Wichtig ist, dass dadurch keine falschen Schlüsse mit Blick auf eine mutmassliche Lohndiskriminierung gezogen werden.
Unerklärt heisst nicht diskriminierend
Genau das versuchen die gängigen statistischen Modelle zur Lohnungleichheit auch tatsächlich zu vermeiden. Diese Modelle streben danach, Männer und Frauen in möglichst vielerlei Hinsicht vergleichbar zu machen. Erst eine vollständige Vergleichbarkeit ermöglicht die Prüfung, ob ein «gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» gezahlt wird, wie es unsere Verfassung verlangt.
Offenkundig ist, dass der Beschäftigungsgrad berücksichtigt werden muss. Ein Maler, der 100 Prozent arbeitet, verdient mehr als seine Arbeitskollegin mit einem Beschäftigungsgrad von 40 Prozent. In dieser Sezierübung berücksichtigt werden auch Faktoren wie das (Dienst-)Alter, das Ausbildungsniveau, die geografische Region, die Branche oder die berufliche Stellung.
Übrig bei solchen Analysen bleibt der Teil der Lohnungleichheit, der sich nicht auf ebendiese berücksichtigten Faktoren zurückführen lässt. Gemäss den Analysen des Bundes beträgt der unerklärte Teil rund 7,8 Prozent, wobei er in der Privatwirtschaft etwas höher liegt als im öffentlichen Sektor.
Ausgefeiltere Studien – wie etwa jene der Arbeitsmarktökonomin Conny Wunsch – finden noch einen unerklärten Teil von etwas über 3 Prozent für den öffentlichen Sektor und rund 6 Prozent für den Privatsektor.
Fehlgeleitet wäre nun der Kurzschluss, dass diese gesamte unerklärte Differenz der Diskriminierung von Frauen entspricht. So lässt sich die totale Arbeitserfahrung oder auch die ständige Verfügbarkeit nicht abbilden – alles Faktoren mit potenziellem Erklärungsgehalt für den Lohnunterschied.
Die Arbeiten der Nobelpreisträgerin Claudia Goldin zeigen, dass die ständige Erreichbarkeit und die zahlreichen Überstunden in bestimmten Jobs einen wichtigen Erklärungsfaktor für die Lohnungleichheit bilden.
Wichtige Lohnverhandlungen
Selbstverständlich gibt es bis heute geschlechterspezifische Unterschiede – in Lohnverhandlungen. Auch neueste Studien zeigen, dass Frauen in der Tendenz weniger kompetitiv sind und tiefere Lohnerwartungen haben als ihre männlichen Kollegen. Ausserdem gibt es bei den heutigen Lehrlingen klare Unterschiede in der Berufswahl – die wiederum Lohnunterschiede zur Folge haben.
Dabei anklagend und pauschalisierend von Diskriminierung zu sprechen, ist jedoch weder faktentreu noch zielführend. Ziel sollte es sein, dass jede und jeder Beruf und Familienmodell frei wählen kann – und dass auch der Lohn in freien Verhandlungen zustande kommt. Nur eben, niemand sollte da sein Lichtchen unter den Scheffel stellen!
Melanie-Häner Müller, «Neue Zürcher Zeitung»