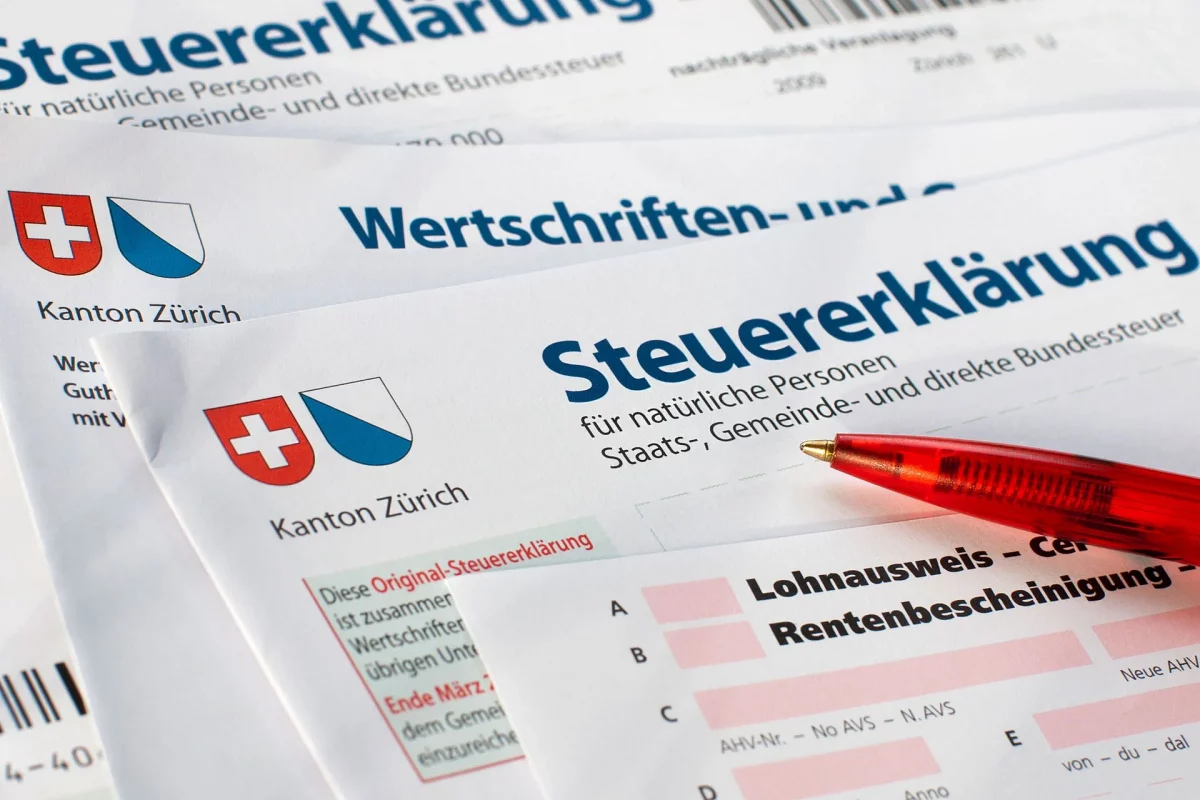«Ehrlich gesagt: Es ist ‹easy money›» – sechs Berufsleute sagen, wie zufrieden sie mit ihrem Lohn sind Ausbildung und Branche bestimmen zu einem grossen Teil, wie viel wir verdienen. Wer einen Hochschulabschluss hat, übertrifft das Durchschnittssalär von 6800 Franken deutlich. Doch ein Garant für Glück ist das nicht, wie unsere nichtrepräsentative Umfrage zeigt.
Ausbildung und Branche bestimmen zu einem grossen Teil, wie viel wir verdienen. Wer einen Hochschulabschluss hat, übertrifft das Durchschnittssalär von 6800 Franken deutlich. Doch ein Garant für Glück ist das nicht, wie unsere nichtrepräsentative Umfrage zeigt.
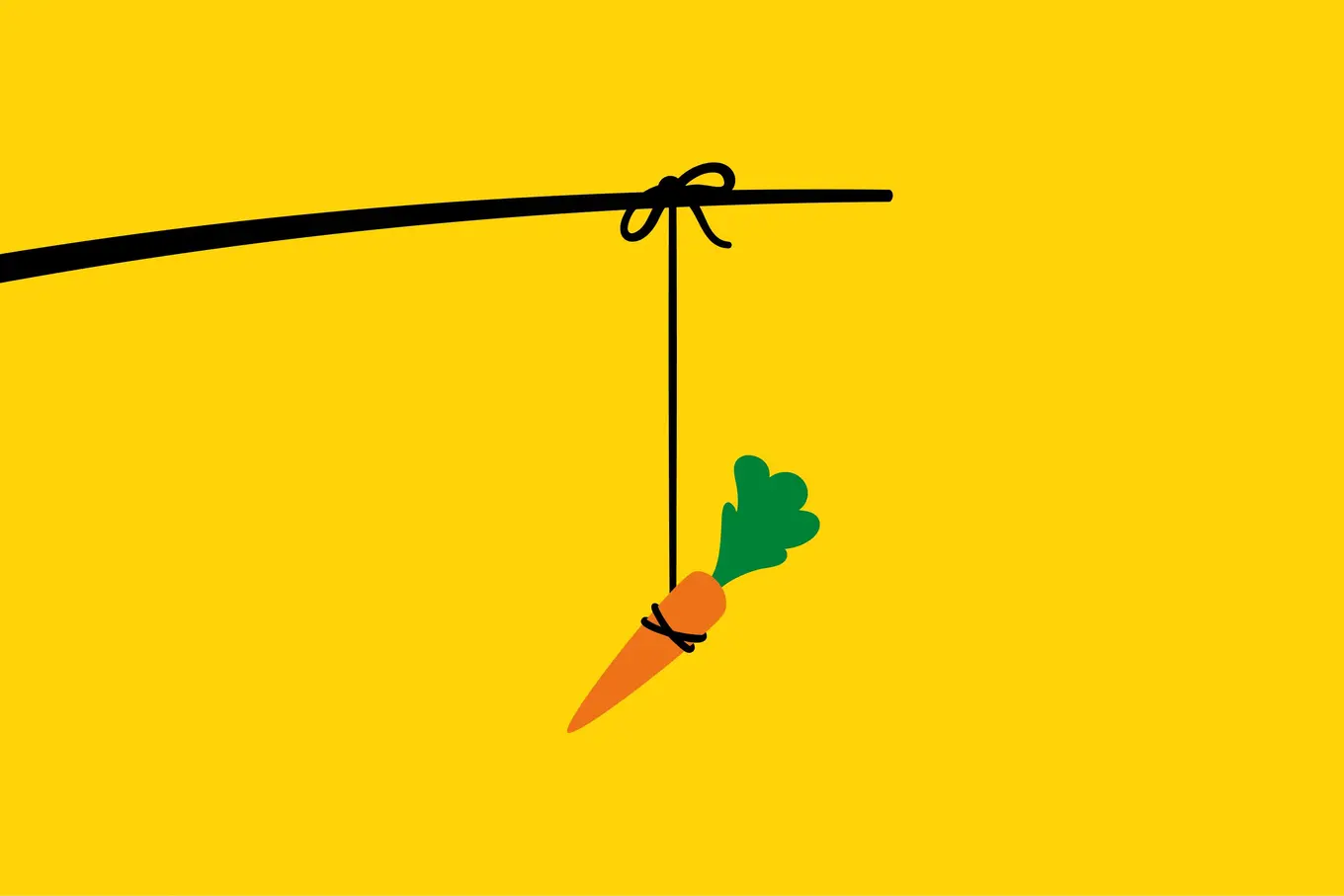
Wirtschaftsförderin: «In der Privatwirtschaft würde ich mehr verdienen»
«Mit einem 80-Prozent-Pensum als Teamleiterin einer Standortförderung eines Mittellandkantons verdiene ich knapp 130 000 Franken jährlich. Ich bin Ökonomin und habe einen MBA, in der Privatwirtschaft könnte ich sicher mehr verdienen. Dennoch bin ich zufrieden mit einem Lohn. Fairness und Sinnhaftigkeit waren mir immer wichtiger als die absolute Höhe des Salärs. Beides stimmt hier. Durch meinen Job habe ich Einblick darein, wie ein Kanton und seine Wirtschaft funktioniert. Ich habe einen guten Draht zu Unternehmen und kenne ihre Sorgen und Herausforderungen ziemlich genau. Zudem habe ich das Gefühl, etwas bewegen zu können. Das Umfeld ist professionell und effizient, die Kultur wertschätzend – da habe ich bei Privatunternehmen ganz anderes erlebt. Ich kann also sagen, dass ich meinen Traumjob gefunden habe. Gleichzeitig habe ich inzwischen aber auch die Grenzen erlebt. In der öffentlichen Verwaltung spielt die Politik eine wichtige Rolle. Manches, was sinnvoll wäre, wird aus politischen Gründen gestoppt. Und natürlich ist unser Einfluss letztlich beschränkt. Wir können die Firmen nicht zu ihrem Glück zwingen. Das empfinde ich manchmal als frustrierend. Ich schliesse deshalb einen Berufswechsel nicht aus. Unterrichten könnte mir gefallen. Die Bezahlung ist dort zwar sicher nicht besser, dafür erhält man ein viel direkteres Feedback auf seine Arbeit.»
«Ich führe ein kleines Unternehmen im Lebensmittelbereich in Zürich, das ich selber aufgebaut habe. Jahrelang habe ich mir nur einen Lohn von 3000 Franken ausbezahlt. Dies würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe mich damit ein Stück weit selbst ausgebeutet. Heute gönne ich mir einen Lohn von 7500 Franken brutto im Monat. Angestellte Handwerker, die in derselben Branche wie ich arbeiten, kommen in Zürich im Schnitt auf rund 5500 Franken. Damit verdiene ich deutlich mehr, doch ich habe neben meiner handwerklichen Tätigkeit auch noch administrative Aufgaben zu erledigen. Für diesen Kram will ich auch entschädigt werden. Ich lebte viele Jahre in einer Wohngemeinschaft. Mittlerweile bewohne ich mit meiner Partnerin, die noch in Ausbildung ist, eine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung an schöner Lage in Zürich. Die Miete dafür beträgt – ortsübliche – 2800 Franken. Gerne würde ich aber etwas mehr Platz zum Wohnen haben. Ich habe mir denn auch zum Ziel gesetzt, dereinst rund 13 000 Franken im Monat zu verdienen. Damit könnte ich mir eine Viereinhalb-Zimmer-Wohnung leisten, für deren Miete in Zürich gut und gerne 4500 Franken verlangt werden. Auch könnte ich so hin und wieder mit meiner Partnerin auswärts essen gehen. Dies tue ich im Moment fast nur in den Ferien.»
Pflegerin: «Es ist schwierig, das Privatleben zu planen»
«Ich arbeite ausschliesslich für die Nachtschicht. Ausserdem bin ich zu 50 Prozent angestellt, damit ich mich als alleinerziehende Mutter um meinen zehnjährigen Sohn kümmern kann. Mein Monatslohn beträgt 2600 Franken, so dass ich zusammen mit den Alimenten knapp über die Runden komme. Meine Schicht im Pflegeheim startet um 21 Uhr 30 und endet um 7 Uhr. Zu zweit betreuen wir 50 Personen. Weil im Moment viele von ihnen dement sind, ist die Arbeit intensiv. Auch körperlich: Wir tragen regelmässig schwere Gewichte – vor allem, wenn jemand umfällt oder gestützt werden muss. Gefordert sind wir ebenso, wenn eine Person halluziniert. Die Nachtschicht verändert meinen Schlafrhythmus: Ich habe jedoch gelernt, damit umzugehen. Wenn ich am Morgen nach Hause komme, gehe ich nicht sogleich ins Bett, sondern erst etwa um 11 Uhr. Oft ist es besser, in zwei Etappen statt an einem Stück zu schlafen. Als belastend empfinde ich es hingegen, dass wir die Einsatzpläne meistens erst zwei Wochen im Voraus erhalten. Früher gaben sie uns einen längeren Vorlauf. Das macht es schwierig, das Privatleben zu planen. Und wenn sie uns um Überstunden bitten, kann man oft nur schlecht Nein sagen.»
Vermögensverwalter: «Seit der Pandemie verbringe ich die meiste Zeit im Home-Office»
«Ein gut bezahlter Job in der Finanzindustrie fällt nicht vom Himmel, im Gegenteil. Ich habe studiert, mich durchgebissen und mit Doktortitel abgeschlossen. Als Politikwissenschafter habe ich eine Stelle im Portfoliomanagement angenommen. Das ist jetzt über zwanzig Jahre her. Bei manchen Firmen war der Job sehr hart, und inspirierend war das Arbeitsleben nicht immer. Auch weil ich mit dem Gehabe am Paradeplatz in Zürich nicht viel anfangen kann. Doch seit ein paar Jahren, seit Corona, haben sich die Dinge verändert. Als Analyst mit Kaderstufe verdiene ich – je nachdem, wie hoch der Jahresbonus ausfällt – zwischen 250 000 und 350 000 Franken. Seit der Pandemie verbringe ich die meiste Zeit im Home-Office und kann die Dinge viel lockerer nehmen. Die Analysen habe ich inzwischen sehr schnell geschrieben. Ich muss nicht mehr ins Büro für unnötige Sitzungen. Das Team ist eingespielt, und mein Chef ist zum Glück kein Kontrollfreak. Unter dem Strich habe ich heute tagsüber einige Zeit für Privates. Wie hoch mein effektives Arbeitspensum ist, weiss ich nicht. Ich würde es auf 60 bis 80 Prozent schätzen, je nach Woche. Verdiene ich so viel, wie ich verdiene? Ehrlich gesagt: Es ist ‹easy money›.»
Verkäuferin: «Auswärts essen gehen wir allenfalls an einem Geburtstag»
«In den Verkauf bin ich nach einer abgebrochenen Lehre über ein Praktikum gekommen. Zuerst habe ich ein paar Jahre bei einer Modekette gearbeitet. Danach habe ich in einen Supermarkt in der Agglomeration gewechselt. Nach fast zehn Jahren verdiene ich dort mit meinem 70-Prozent-Pensum netto rund 2500 Franken im Monat. Angemessen fände ich mindestens 3000 Franken. Denn die Arbeit ist körperlich anstrengend, und es sind lange Tage – in der Regel mehr als zehn Stunden plus die Pausen. Auch weil oft Kollegen fehlen. Es wird zwar immer von Aufstiegsmöglichkeiten im Betrieb gesprochen, aber in der Realität ist das schwierig. Darum leiste ich mir eine Weiterbildung. Ich bin jetzt Ende 30 und hoffe, dereinst in einem Büro arbeiten zu können. Dort könnte ich dann auch einmal um 17 Uhr nach Hause gehen statt erst gegen halb 8 Uhr abends! Am Ende des Monats bleiben mir vielleicht ein paar hundert Franken übrig. Auswärts essen gehen wir allenfalls einmal an einem Geburtstag. Mein Mann verdient zwar auch etwas, aber in die Ferien zu verreisen, das können wir uns als Familie mit zwei Kindern nur einmal im Jahr leisten. Da fahren wir zu unserer Familie in Südeuropa.»
Marketingmanager: «Mein Lohn ist auch ein goldener Käfig»
«Ich bin 41 Jahre alt und seit mehr als fünf Jahren Marketingleiter in einem Industriebetrieb im Kanton Solothurn. Es ist mir bisher immer gut gelungen, meine Interessen in Lohnverhandlungen durchzusetzen. Mit meinem derzeitigen Gehalt von etwa 205 000 Franken inklusive Bonus bin ich zufrieden. Vor einem Jahr konnten meine Frau und ich ein Eigenheim für unsere Familie kaufen. Unter meinen Studienkollegen von der Universität gehöre ich zu den Gutverdienern. Doch inzwischen habe ich erkannt, dass dieses Gehalt auch ein goldener Käfig ist: Ich habe mich bereits auf andere Stellen in meiner Branche beworben, die mir im Arbeitsalltag mehr Sinn gäben, jedoch deutlich schlechter bezahlt sind. Da ich der Hauptverdiener in meiner Familie bin, kommt eine signifikante Gehaltsreduktion derzeit nicht infrage. Dennoch hoffe ich, mittelfristig eine Position zu finden, die mich nicht nur finanziell, sondern auch intellektuell erfüllt. Weniger Wochenendarbeit und weniger Auslandsreisen wären ebenfalls eine Verbesserung.»