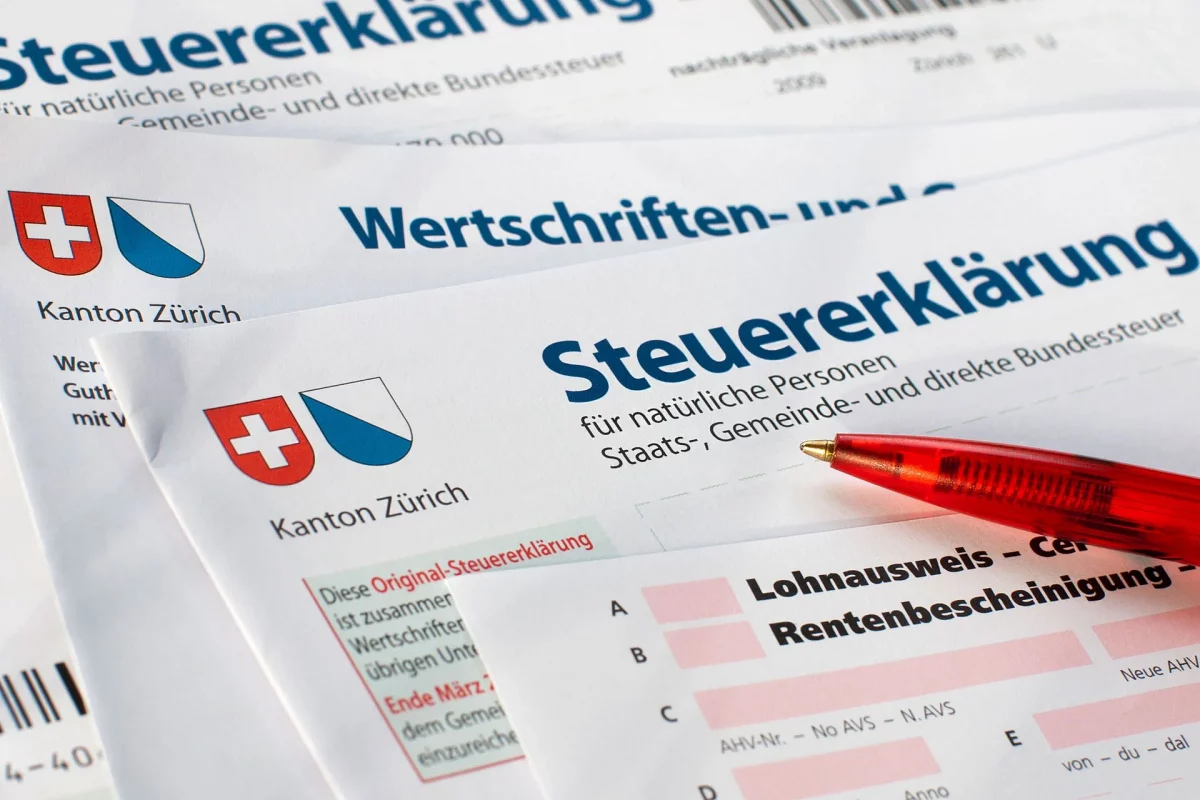Pierin Vincenz: Wie er wurde, was er ist Der Raiffeisen-Chef war lange der beliebteste Banker der Nation. Doch in der Finanzkrise verlor Pierin Vincenz die Bodenhaftung. Eine kurze Geschichte von Aufstieg und Fall.
Der Raiffeisen-Chef war lange der beliebteste Banker der Nation. Doch in der Finanzkrise verlor Pierin Vincenz die Bodenhaftung. Eine kurze Geschichte von Aufstieg und Fall.

Während Pierin Vincenz im Zürcher Volkshaus vor den Bezirksrichter tritt, stehen wenige hundert Meter entfernt Raiffeisen-Kundinnen und -Kunden vor der Wahl: Sollen sie helfen, das Werk des gefallenen Bankchefs zu demontieren?
Die Niederlassung Zürich-Wiedikon wird dieses Jahr in die Hände von Genossenschafterinnen und Genossenschaftern übergehen. Geld aus dem Dorf für das Dorf. Das war der Grundgedanke der 1899 im Thurgauer Bauerndorf Bichelsee gegründeten Raiffeisen.
Wer 2022 im hippen Kreis 3 diesem romantischen Gedanken nachhängt, kann jetzt Anteilscheine zeichnen, 500 Franken das Stück. Mit diesem Geld wird die Filiale Wiedikon der Raiffeisen-Zentrale in St. Gallen wieder entzogen.
Dort hatte Pierin Vincenz von 1999 bis 2015 die Zügel fest – besser: immer fester bis zur Hybris – in der Hand gehalten. Unter anderem beschloss er, aus der Ostschweiz heraus die drei Grossen, Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank, in ihrem Stammgebiet anzugreifen.
Ein Gedanke, der lange auch vielen der 1,9 Millionen Raiffeisen-Genossenschafterinnen und -Genossenschaftern im Land gefiel. Obwohl er ziemlich weit weg vom Selbsthilfegedanken ist.
Man kann über Pierin Vincenz sprechen, mit wem man will, ob mit Weggefährten, Feinden, Freunden, Verhandlungspartnern, Vorgesetzten oder Untergebenen: Selbst jetzt, wo Pierin Vincenz vom Zürcher Bezirksgericht strafrechtlich verurteilt ist, steht am Schluss immer noch die Frage: Was wird unter dem Strich in Erinnerung bleiben?
Dass Vincenz den angestaubten Raiffeisen-Verbund modernisiert und zur drittgrössten Kraft auf dem hiesigen Finanzplatz gemacht hat? Oder dass der langjährige Chef sich auf eine Reihe von verdeckten Deals eingelassen hat, um in seine eigene Kasse zu wirtschaften, und en passant eine «Tour de Suisse durch das Rotlichtmilieu» unternahm?
Zwei Dinge vorweg: In über einem Dutzend Gesprächen kam niemand zu einer eindeutigen Antwort. Und: Schon vor der Vorurteilung sah es in der Summe nicht gut aus für Pierin Vincenz.
Wie er aufstieg
Der 65-Jährige hat sich immer als «Spätzünder» bezeichnet. Im bündnerischen Andiast als viertes und jüngstes Kind des CVP-Politikers Gion Clau Vincenz aufgewachsen, lebt Pierin fürs Fussballspielen. Er ist ein miserabler Schüler, fliegt in Disentis aus dem Internat, schafft in Chur mit Ach und Krach die Matura.
Vincenz heuert in einem Treuhandbüro an, finanziert sich damit das Reisen. Mit 26 Jahren zieht es ihn an die Hochschule St. Gallen (HSG), und er gibt Vollgas. Lizenziat, Doktorat, Einstieg beim Bankverein (heute Teil der UBS), Wechsel zur Industriefirma Hunter Douglas.
Nach einem Aufenthalt in Chicago kehrt Vincenz in die Schweiz zurück und leitet ab 1997 das Departement Finanzen im Verband der Raiffeisenbanken, den sein Vater bis 1992 präsidiert hat. 1999 übernimmt er, 43-jährig, die Geschäftsleitung.
An der Spitze angekommen, drückt Pierin Vincenz erst recht aufs Tempo. Die Raiffeisen-Gruppe legt ihr verstaubtes Image ab und modernisiert das Filialnetz. Sie stösst in die Städte, ins Reich der Grossbanken vor, schwingt sich zur Nummer 1 im hiesigen Hypothekenmarkt auf.
Sie baut Beteiligungen an Kreditkartenanbietern auf, an Versicherungen, an Privatbanken, an Finanzderivat-Boutiquen. Und mittendrin, wenn immer möglich als Verwaltungsrat, ist Pierin Vinzenz.
Seine Zwischenbilanz: Die Raiffeisen-Gruppe, die als Genossenschaft Landwirten den Zugang zu Krediten ermöglichen sollte, wird in der Schweiz zu einem Konkurrenten für CS, UBS und ZKB.
Grösste Tugend? Entscheidungsfreude. Grösstes Laster? Schlemmen. Berufliches Vorbild? Franz Beckenbauer. Das sagt Vincenz 2006 in einem NZZ-Interview über sich selbst.
Wie sehen ihn andere, damals im Jahr 2018, als er nicht mehr an der Spitze der Raiffeisengruppe steht und die ersten Vorwürfe gegen ihn lauter werden?
Ein charismatischer Visionär und Macher, sagen fast alle. Ein harter Verhandler, sagt ein Privatbankier. Ein mit sich grosszügiger Mensch, sagt einer, der Vincenz’ Spesenbelege gesehen hatte. Ein grosszügiger Denker, sagt ein langjähriger Mitstreiter.
Einer, der mit Kritik umgehen könne, sagt ein Finanzjournalist. Einer, der über den Tellerrand hinausdenke, sagt einer im Bundeshaus. Ein bodenständiger Manager, frei von jeder Arroganz, sagt eine ehemalige Untergebene.
Ein glänzender Unterhalter, sagt ein Raiffeisen-Kunde. Einer, der sich nie habe unterkriegen lassen, auch dann nicht, als das Leben ihm und seinen Töchtern die Ehefrau und Mutter geraubt habe, sagt ein Bekannter.
Einer von uns, heisst es lang an der Basis, bei den 1,9 Millionen Genossenschaftern.
Wie er abhob
Das ist vielleicht das Erstaunlichste an Pierin Vincenz’ Aufstieg. Obwohl er zunehmend wie einer der bei Volk und Politik in Misskredit geratenen Banker lebt – Helikopterflüge, chauffierte Limousinen, Millionengehalt und -bonus, schmal geschnittene Anzüge –, bleibt er «einer von uns».
Das hat paradoxerweise mit einem unschweizerischen Wesenszug von Vincenz zu tun: mit seiner furchtlosen Lust an der Provokation, seiner felsenfesten Überzeugung, dass Pierin Vincenz in aller Regel recht hat, mit seinem unverhohlenen Drang, mit Erfolgen aus der Masse herauszustechen.
Kurz: Vincenz verkörpert die Sehnsucht der Schweizer nach Typen, die sich etwas trauen. In Kombination mit dem betriebswirtschaftlichen Erfolg der Bankengruppe wird der Chef unantastbar.
Die Raiffeisen-Delegierten kritisieren die teure Expansion ins Private Banking und ins Assetmanagement, aber nur hinter vorgehaltener Hand. Der Verwaltungsrat akzeptiert, dass Vincenz mit der Rechtschefin der Raiffeisengruppe verheiratet ist.
Als 2013 der Bund und die Gross- und Privatbanken mit der EU um die Rettung des Bankgeheimnisses ringen, fallen Vincenz und Eveline Widmer-Schlumpf ihnen in den Rücken – und geniessen trotzdem die Sympathie vieler Schweizer.
Die Finanzkrise 2008 und die Schwarzgeldaffären vieler Banken haben das Verhältnis des Landes zu seinem Finanzplatz verändert. «Ich bin kein Grossbanker», scheint Vincenz bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu zeigen.
Dabei soll es ihn gewurmt haben, dass die CEO von CS und UBS ein Mehrfaches verdienten. Aber offenbar nicht wegen des Geldes an sich, «nein, die Lohnsumme war für ihn eine messbare Form der Anerkennung», sagt ein Bekannter.
Wenn man so will, war es die Schweizerische Nationalbank, die Vincenz auch implizit recht gab: Sie stufte die Raiffeisen-Gruppe 2014 als «systemrelevante Bank» ein.
Sprich: Wenn sie in Nöte gerät, hängt der Finanzplatz dran, der Staat müsste ihr zu Hilfe eilen. Ebendies musste der Bund auf dem Höhepunkt der Finanzkrise bei der UBS tun, die er aus dem selbstverschuldeten Schlamassel rettete.
Die Raiffeisenbank dagegen hat sich zum Marktleader im Hypothekenmarkt aufgeschwungen, ohne dass – soweit heute absehbar – die Qualität der vergebenen Hypotheken sich verschlechtert hätte.
Die Bank ist in ihrem Kernbereich also solide geführt. Und warum genau soll der UBS-Chef mehr verdienen als Vincenz? Darin kann, wer unbedingt will, eine Ungerechtigkeit sehen.
Andere könnten gut mit einem Salär von 2,5 Millionen leben, aber Vincenz legt noch einen Zacken zu. Fast scheint es, als möchte er allen beweisen, dass er auch mehr kann als Hypotheken vergeben.
Mit der Übernahme der Bank Notenstein schlägt er einen teuren Diversifikationskurs ein. Die Raiffeisenbank soll im Private Banking und im Assetmanagement zu einer Macht werden. Vincenz interessiert sich für eine Übernahme der Bank Sarasin, will die Beteiligung an der Bank Vontobel erhöhen.
Die Bank will sich als Drehscheibe für Beteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen etablieren. Der Name der Gesellschaft: Investnet AG. Sie war eine der Firmen, die im Zentrum des Prozesses gegen Vincenz und Konsorten standen. Wollte er sich hier die Millionen, die ihm versagt blieben, holen?
Auch wenn strafrechtlich nichts an Vincenz hängen geblieben wäre, gesellschaftlich ist er sowieso erledigt. In einem Land wie der Schweiz bekommen gefallene Stars keine zweite Chance.
Man erinnere sich an FDP-Bundesrätin Elisabeth Kopp oder den SAirGroup- und NZZ-Präsidenten Eric Honegger, die nach ihrem Fall die Gnadenlosigkeit des Landes in der ganzen Härte zu spüren bekamen.
Leute, die ihn lange umschwärmten, werden ihn für immer konsequent schneiden. An diesen Gedanken hat sich Vincenz wahrscheinlich schon gewöhnt.
Der ehemalige Raiffeisen-Chef hätte als Lichtgestalt Eingang in die Geschichte des Finanzplatzes finden können. Dass es nun nicht so kommt, liegt nur an einem Mann: an Pierin Vincenz selbst.
Dieser Artikel ist am 11. März 2018 in der «NZZ am Sonntag» erschienen und wurde für den Raiffeisen-Prozess überarbeitet und aktualisiert.