Prokrastination: Wer alles aufschiebt, bringt nie etwas Grossartiges hervor. Betroffene leiden darunter. Aber es gibt Hilfe Fast jeder schiebt Aufgaben vor sich her. Für jeden Zehnten ist das extrem belastend. Zum Beispiel für Manuel Wälti. Er erzählt, wieso er im Job offen damit umgeht – und wie er sein Leben ändern will.
Fast jeder schiebt Aufgaben vor sich her. Für jeden Zehnten ist das extrem belastend. Zum Beispiel für Manuel Wälti. Er erzählt, wieso er im Job offen damit umgeht – und wie er sein Leben ändern will.
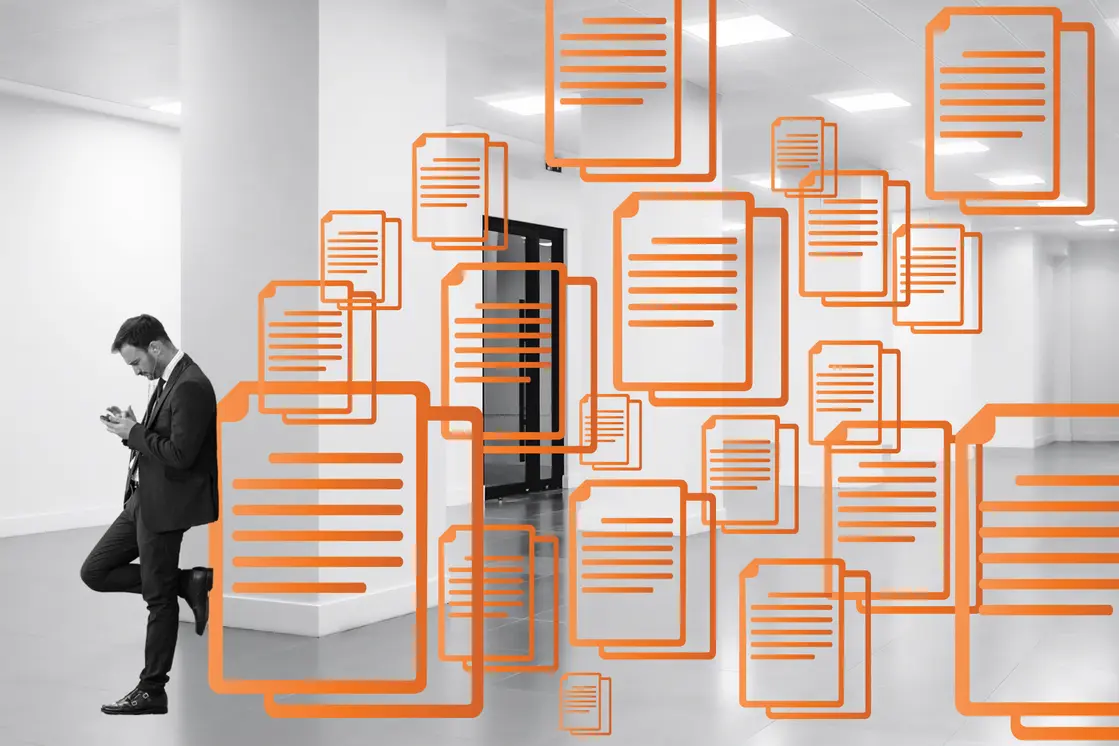
«Ich prokrastiniere.» Wenn Manuel Wälti ein Bewerbungsgespräch hat und sein potenzieller Arbeitgeber ihn fragt, welche Schwächen er habe, dann muss er nicht lange überlegen. Er schiebt alles auf, was zu tun ist. Und er hat kein Problem damit, das zuzugeben.
Manuel Wälti sitzt in seinem Wohnzimmer am Esstisch, während er davon erzählt. An einem Tischende liegen sauber aufgereiht Arbeitsbücher: Deutsch als Fremdsprache. Manuel Wälti ist Sprachlehrer für Expats, die bei grossen Unternehmen in der Schweiz arbeiten. Er hat einen Job. Er habe immer einen gefunden.
Trotz seiner Ehrlichkeit? Oder deswegen? Wer weiss. «Mit meiner Antwort rechnet jedenfalls keiner», sagt er. Und dann erkläre er im Vorstellungsgespräch, was die Aufschieberitis für ihn bedeute: «Ich versichere, dass ich ein verantwortungsbewusster Mensch bin. Ich erledige meine Aufgaben. Allerdings in letzter Minute.» Für Arbeitgeber, die das nicht in Ordnung finden, möchte er nicht tätig sein. Und er sagt: «Wäre ich nicht von Anfang an ehrlich, würde ich ständig Theater spielen.»
Nur 2 Prozent der Menschen schieben nie auf
Wozu auch? Der Basler ist keine Ausnahme. Laut einer Studie der Universität Münster sagen nur 2 Prozent der Befragten, dass sie Aufgaben grundsätzlich sofort erledigten. 98 Prozent schieben mehr oder weniger regelmässig Tätigkeiten vor sich her.
Wer nur kurz darüber nachdenkt, kann sich selbst vermutlich einreihen: die Präsentation für die Chefin vorbereiten, die Steuererklärung ausfüllen, das Chaos im Keller aufräumen – es gibt Tätigkeiten, die soll lieber das Zukunfts-Ich erledigen. Wer noch unsicher ist, kann mit dem Selbsttest der Universität Münster herausfinden, wie ausgeprägt die eigene Aufschieberitis ist.
Aber es gibt einen Unterschied zwischen gewöhnlichen Aufschiebern und Menschen wie Manuel Wälti, die prokrastinieren. Margarita Engberding, Psychologin an der Prokrastinationsambulanz der Universität Münster, sagt: «Wir nutzen das Wort Prokrastination nur bei Personen, die krankhaft aufschieben, darunter leiden und deshalb Hilfe benötigen. Das sind etwa 10 Prozent der Menschen.»
Einer von ihnen ist Manuel Wälti. Er schiebt Pflichten genauso auf wie Schönes. Letzteres ist besonders bitter für ihn. Er senkt den Kopf, schüttelt ihn und erzählt: «Mir ist etwas Blödes passiert. Ich wollte Kurzgeschichten, die ich geschrieben habe, bei einem Wettbewerb einreichen. Aber ich hätte sie noch einmal leicht überarbeiten müssen. Ich habe das von einem Tag auf den anderen verschoben. Und auf einmal war der Abgabetag verstrichen.»
Er seufzt und sagt: «Das macht mich total unglücklich. Ich schaffe es nicht, solche Aufgaben rechtzeitig zu beginnen.»
Wer prokrastiniert, leidet
Manuel Wälti teilt die Aufgaben seines Lebens innerlich in drei Listen ein: die Muss-Liste, die Soll-Liste, die Könnte-Liste. Die Vorbereitungen für seine Sprachschüler: Muss-Liste. «Das wird erledigt, wenn auch auf den letzten Drücker. Die Konsequenzen wären zu negativ. Ich muss schliesslich Geld verdienen.» Während er solche Dinge aufschiebt, plagen ihn Schuldgefühle. Handlungsfähig werde er aber erst, sobald die Zeit extrem dränge.
Auf der Soll-Liste steht zum Beispiel die Steuererklärung: «Die kann man recht weit aufschieben, bis sie auf die Muss-Liste wandert.» Auf der Könnte-Liste stehen Wünsche und Träume. Zum Beispiel: Kurzgeschichten bei einem Wettbewerb einreichen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge jemals erledigt werden, ist gering.
Manuel Wälti sagt: «Ich schiebe mein Leben auf.» Es stört ihn. So richtig. Er leidet. Und das kann Folgen haben. Eine Studie aus Schweden, an der über 3000 Studierende teilgenommen haben, zeigt: Wer prokrastiniert, hat in der Folge eher gesundheitliche Probleme wie Schlafstörungen und Depressions-, Angst- oder Stresssymptome und leidet eher unter Einsamkeit.
Der 65-jährige Manuel Wälti hat eine Frau und eine erwachsene Tochter. Er sagt: «Wir sind eine glückliche Familie.» Wenn er jedoch nur sich selbst betrachtet, sagt er: «Ich bin jeden Tag unglücklich. Weil ich aufschiebe.»
Der fröhliche Aufschieber
Auf den ersten Blick gleicht Manuel Wältis Verhalten der Aufschieberitis von Andreas Harder. Der 40-Jährige vertagt ebenfalls, was er kann, seit er denken kann. Seine Mutter habe es schon in seiner Primarschulzeit aufgegeben, ihn ändern zu wollen, und schliesslich gesagt: «Ab heute bist du selbst für deine Hausaufgaben verantwortlich.»
Kein Problem. Der Junge wusste, er war im Klassenraum das zehnte Kind von links gezählt und das vierzehnte von rechts. «Also habe ich kurz vor dem Unterricht die zehnte und die vierzehnte Aufgabe gemacht.» Es folgte ein naturwissenschaftliches Studium, in dem er in zeitliche Probleme beim Schreiben der Abschlussarbeit geriet. «Aber zum Glück war mein Professor genauso eine Trantüte wie ich. Ich musste keine Verlängerung beantragen. Er hatte vergessen, mich anzumelden.» Eine Doktorarbeit wäre schön gewesen, «aber mein Prof und ich haben das nicht zielstrebig genug verfolgt».
Er scheint es nicht zu bedauern. Heute arbeitet Andreas Harder im IT-Support eines bekannten Biotech-Unternehmens; vor allem im Home-Office. «Das ist super. Zwei bis drei Stunden pro Tag kann ich so für die Hausarbeit aufbringen, zum Beispiel Wäsche aufhängen oder kochen.» Das Gespräch übers Aufschieben mit ihm ist kurz. Die Zeit fehlt, denn er hatte die Interviewanfrage zu lange unbeantwortet gelassen. «Es hatte irgendwie nicht gepasst, zu antworten.»
Andreas Harder heisst eigentlich anders. Zwar sagt er: «Mein Chef hat bestimmt schon mitbekommen, dass ich aufschiebe.» So ehrlich wie Manuel Wälti war er aber nicht. Vorsichtshalber will er deshalb unkenntlich bleiben.
Krankhafte Aufschieber bleiben unter ihren Möglichkeiten
Der 40-Jährige sagt, er sei mit seinem Leben zufrieden. «Manchmal fragen mich ehemalige Kollegen, die jetzt in anderen Abteilungen sind und viel mehr Verantwortung haben, ob ich mich nicht auch weiterentwickeln wolle», erzählt er. «Aber wieso denn? Ich sehe doch, wie viel Stress die haben. Mein Leben ist toll, so wie es ist.»
Manuel Wälti hingegen sagt: «Menschen, die prokrastinieren, bleiben unter ihren Möglichkeiten.» Denn wer nur unter Druck und in letzter Minute anfange zu arbeiten, liefere immer nur das Minimum. «Wir sind mittelmässig und bringen nichts Grossartiges hervor», sagt er und klingt weitaus weniger zufrieden als Andreas Harder.
Menschen wie Andreas Harder nennt Margarita Engberding fröhliche Aufschieber. In einer Studie, an der sie beteiligt war, heissen sie etwas sachlicher «unconcerned delayers». Dort stuften sie und ihr Team 10 Prozent der Befragten als krankhafte Prokrastinierer mit Leidensdruck ein und ebenfalls 10 Prozent als sorglose Aufschieber. Das Verhalten beider Gruppen ist ähnlich. Der Umgang damit ist aber unterschiedlich. «Die fröhlichen Aufschieber werden nur etwas ändern, wenn der Druck von aussen zu gross wird. Für sie selbst ist das ja kein Problem», sagt Margarita Engberding.
Die Gründe fürs Prokrastinieren
Auf die Frage, warum sie nicht aufhörten, Dinge aufzuschieben, antworten Manuel Wälti und Andreas Harder jeweils: «Ich bin eben so. Ich war schon immer so.» Manuel Wälti vermutet, es könnte etwas mit den Genen zu tun haben. Denn: «Auch meine Mutter schob alles auf. Das war geradezu ihr ‹way of life›.»
Ist Prokrastination vererbbar? Eine Studie hat Hinweise darauf gefunden. Aber sie hat Tücken, denn darin ging es nur am Rande um Prokrastination. Im Fokus stand die Impulsivität, also die Neigung, schnell und unüberlegt zu handeln. Impulsives Verhalten könne einer von mehreren Gründen sein, Dinge aufzuschieben, sagt Tabea Scheel, Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Flensburg. Denn die Betroffenen beginnen mit ihren Pflichten tendenziell später, weil anderes angenehmer ist.
Manuel Wälti gibt zu: «Was die Gesellschaft von mir verlangt, steht nicht unbedingt auf meiner eigenen Prioritätenliste.» Was dort steht? «Singen, Gitarre spielen, lesen, kochen.»
Gemäss der Psychologin Margarita Engberding kann Prokrastination auch ein Symptom einer Depression oder von ADHS sein. «In solch einem Fall sollte die zugrunde liegende Erkrankung behandelt werden», sagt sie. Doch es gebe auch Menschen, die ohne Vorerkrankung prokrastinierten.
Mit ihrem Team hat die Psychologin Diagnosekriterien für das krankhafte Aufschieben entwickelt. Sie sagt: «Wir betrachten Prokrastination als ernstzunehmende Störung der Selbstregulation.» Die Betroffenen haben eine regelrechte Abneigung gegenüber manchen Aufgaben und lassen sie lange unerledigt, obwohl sie dadurch negative Konsequenzen fürchten. Das sei charakteristisch für Probleme der Selbstkontrolle. Die Ursachen dafür müssen individuell betrachtet werden. Dazu können prägende Erfahrungen mit Leistungsdruck, Misserfolgen, negativer Bewertung und Versagensangst gehören.
Lösungen: raus aus der Aufschieb-Spirale
Doch es sei weder nötig noch förderlich, allzu tief in der Persönlichkeit zu graben, um das Problem zu lösen. Eigentlich sei es sehr natürlich, aufzuschieben. Margarita Engberding fragt etwas provokant: «Wieso sollte ich nicht prokrastinieren, wenn ich gerade keine Lust auf die Aufgabe habe?»
Tabea Scheel betont, dass die Gründe nicht immer nur in der Person selbst lägen; vor allem bei Prokrastination am Arbeitsplatz. «Im Job gibt es zunehmend komplexe Aufgaben. Eventuell hat die Führungskraft nicht gut genug erklärt, was zu tun ist und weshalb ich das tun soll», sagt die Professorin, die auch Coach für Betroffene ist.
Manuel Wälti ist letztlich stärker daran interessiert, das Problem zu lösen, als die Ursachen im Detail zu verstehen. Vor vier Jahren wollte er sich zum ersten Mal in seinem Leben professionelle Hilfe suchen. Aber Prokrastination ist keine anerkannte Krankheit. Die Krankenkasse übernimmt deshalb keine Kosten für eine Verhaltenstherapie. Also gründete er eine Selbsthilfegruppe.
Seine Bilanz: «Ich hatte zwei feste Gruppen mit bis zu zehn Personen. Aber nach drei oder vier Monaten sind sie jeweils auseinandergebrochen. Alle hatten plötzlich eine Ausrede.» Momentan tausche er sich regelmässig mit einer Betroffenen aus Zürich aus. «Was uns am besten hilft, sind Tagesziele», sagt er.
Die Tipps der Forscherinnen
Klar abgesteckte Tagesziele empfiehlt auch Tabea Scheel in ihrem Coaching, genauso wie gewisse Grundsätze: Das Handy konsequent zur Seite legen, aufs Home-Office verzichten, eng mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen zusammenarbeiten, damit es weniger Gelegenheit zum Prokrastinieren gebe, mit Belohnungen arbeiten: Wenn ich die Aufgabe geschafft habe, darf ich richtig gut essen gehen.
Margarita Engberding sammelte gute Erfahrungen mit einem verhaltenstherapeutischen Programm, das sie mit ihrem Team entwickelt hat. Die Betroffenen lernen unter anderem, pünktlich zu beginnen, realistisch zu planen und ihr Verhalten in einem Arbeitstagebuch zu protokollieren.
Wer mitmacht, profitiert – auch auf längere Sicht. Das zeigen die Auswertungen des Programms. Aber für immer befreit von der Prokrastination sind viele danach wohl nicht.
Mit dem Alter wird die Prokrastination weniger
Manche Menschen wie Manuel Wälti begleitet die Prokrastination ein Leben lang. Zumindest eine gute Nachricht haben Tabea Scheel und Margarita Engberding für ihn. Mit dem Alter und beruflicher Erfahrung verringere sich die Prokrastination, sagen beide. Tabea Scheel erklärt: «Die Leute müssen zum wiederholten Male ihre Steuererklärung ausfüllen, halten Präsentationen und erledigen komplexe Aufgaben. Sie sehen, dass es klappen kann.»
Manuel Wälti ist nicht sicher, ob das auf ihn zutrifft: «Ich prokrastiniere heute noch genauso viel wie als Student.» Aufgeben will er aber nicht. «Ich arbeite weiter an mir», sagt er entschlossen und strahlt dabei ein beneidenswertes Durchhaltevermögen aus.
Eva Mell, «Neue Zürcher Zeitung»






