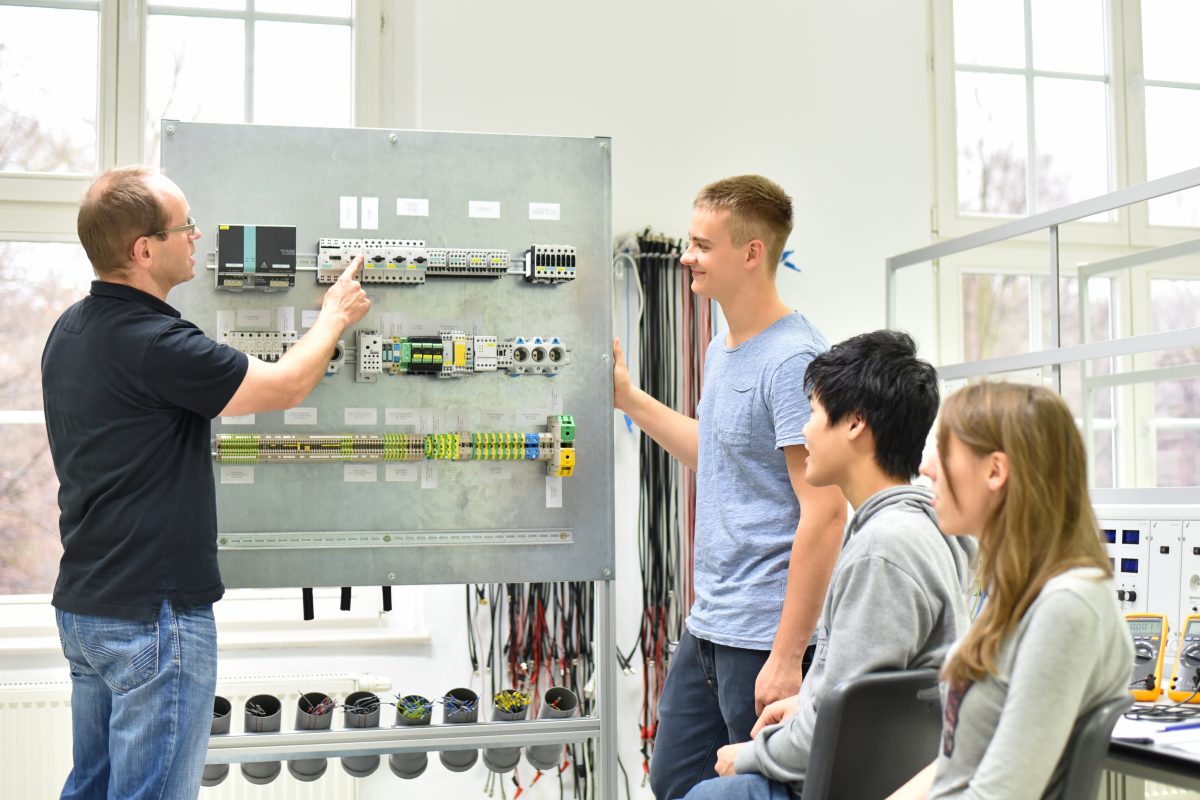«Um 11 Uhr ging auch mal der Kühlschrank auf; für einen Schluck Weisswein» – Erinnerungen einer pensionierten Generation an die Arbeitswelt «Burnout», «#MeToo»-Bewegung oder «Work-Life-Balance» kannte man anno dazumal noch nicht. War früher alles besser? Das hängt davon ab, wen man fragt.
«Burnout», «#MeToo»-Bewegung oder «Work-Life-Balance» kannte man anno dazumal noch nicht. War früher alles besser? Das hängt davon ab, wen man fragt.

«Vor dreissig Jahren konnte man noch direkt zum Bundesrat, wenn es etwas zu verhandeln gab», erinnert sich Fred Scholl (Jahrgang 1951), einst stellvertretender Generalsekretär beim Personalverband des Bundes (PVB), «und je nach Bundesrat ging dann um 11 Uhr der Kühlschrank auf; für einen Schluck Weisswein.»
1967, an seinem ersten Arbeitstag bei der Nestlé in Vevey, wurde Hanspeter Bornhauser (Jahrgang 1941) in die Disziplin eingeführt: 7 Uhr 45 im Hauptgebäude antreten. Zweimal darf man sich verspäten, beim dritten Mal folgt die Kündigung. Später traf Bornhauser auf der Strasse einen Engländer, den er von der Arbeit kannte: «Der hatte nichts mehr zu tun – er war dreimal zu spät gekommen.»
Arbeit besetzt während vieler Jahre den Grossteil der Zeit, über die ein Mensch verfügt. Sie füllt die Stunden, Tage und Wochen, bis das Arbeitsleben irgendwann voll ist. Was erlaubt ist und was gefordert wird, welchen Umgang die Kollegen miteinander pflegen und wie man es überhaupt mit der Arbeit hält, ist darum prägend. Und stets auch ein Abbild der Zeit, in der man gerade sein Geld verdient. War früher alles besser? Das hängt davon ab, wen man fragt.
Das Tenue
Als Hans Weber (Jahrgang 1939) Anfang der sechziger Jahre am Gymnasium Frauenfeld als Vicarius aushalf, trugen alle Lehrer Krawatte. Als er 2004 als Rektor des Gymnasiums Romanshorn in Rente ging, war er der Einzige, der noch eine umgebunden hatte. Zu diesem Zeitpunkt hätten manche Lehrer im Sommer sogar Shorts getragen – «und Sandalen ohne Socken!».
1968 war Hannelore Uphues (Jahrgang 1943) «im Rausch der Revolution»: Die ersten Jeans wurden getragen, Miniröcke auch und Hippie-Kleidung ebenso. Bei der Arbeit zeigte sich diese Revolution vor allem darin, dass die Frauen ihre Kleider ablegten und fortan Hosen trugen: «Sie wollten den Männern nacheifern und dachten, in Hosen würden sie professioneller wirken.» Das hat Uphues, die gerade ihre Ausbildung zur Erzieherin machte, nie ganz nachvollziehen können. Sie trage bis heute lieber Kleider. «Schöne Kleider», das sei ihr wichtig.
Auch der ehemalige Chemielehrer Hans Eggmann (Jahrgang 1938) sagt, früher habe man mehr auf Formen geachtet. Im Umgang und auch in der Garderobe. «Wir sind mit Anzug und Krawatte zur Arbeit. Maximal mit einem kurzärmeligen Hemd im Hochsommer, wenn es sehr heiss war.»
Das Du
Eggmann und Weber bauten ab 1969 gemeinsam mit weiteren Lehrern die Kantonsschule Romanshorn auf. Die Strukturen waren neu, die Leute jung: Mit den meisten Kollegen war man an der neuen Kantonsschule rasch per Du. Eine Seltenheit, siezte man sich doch anderswo oft bis zur Rente. Mit einer Person jedoch wollte das Duzismachen auch in Romanshorn nie so recht klappen.
Die erste Frau am Kollegium – «sehr selbstbewusst, hatte kein Problem, sich durchzusetzen», sagt Weber – wurde fast bis zur Rente von den meisten gesiezt. «Man musste ja immer den richtigen Moment abpassen, um Duzis zu machen. Und den gab es bei ihr nie. Sie kam nach dem Konvent nie etwas trinken mit uns», sagt Eggmann. Die Frau hatte drei Kinder, sie konnte nicht einfach mit den Kollegen – meist selber Familienväter – sitzen bleiben.
Nach vielen Jahren beschloss Weber, längst zum Rektor befördert, diesen «unhaltbaren Zustand» zu ändern. Er sorgte dafür, dass er beim nächsten offiziellen Anlass neben der Kollegin sass, stiess mit ihr an und meinte, es sei doch eine Unmöglichkeit, dass sie beide nun seit mehr als zwanzig Jahren zusammenarbeiteten, ohne sich zu duzen. Wie hatte das nur passieren können?
Nun, sagte die Frau, sie sei als Hilfslehrerin ins Kollegium eingetreten, während Weber bereits Hauptlehrer war. Also habe sie sich nicht getraut, ihm das Du anzubieten. Er hätte das tun müssen, befand sie. «Aber einer Frau trägt man das Du nicht einfach so an. Zudem war sie drei Jahre älter als ich. Also habe auch ich mich nicht getraut», sagt Weber. Bald nachdem die Frau zur Hauptlehrerin befördert worden war, wurde Weber Rektor, «da hat sie sich erst recht nicht mehr getraut, mir das Du anzutragen». Man lachte, man stiess an, man sagte fortan «du».
Der Umgang
«Mobbing?» Der ehemalige Rektor Weber schüttelt den Kopf. «Aber», sagt er dann und mit Nachdruck, «bloss weil es das Wort bei uns noch nicht gab, heisst das nicht, dass wir das Verhalten nicht kannten.» Er selber habe nie Mobbing erfahren, es aber gelegentlich beobachtet. #MeToo? Er schüttelt erneut den Kopf: «Hatten wir nicht. Aber wir hatten einmal eine Hochzeit im Kollegium.»
Frauen, etwa die deutsche Lehrerin Gesche Ahlers (Jahrgang 1942), haben es anders erlebt. In ihrem Fall nicht während der Arbeit, sondern in der Ausbildung. Einer ihrer Lehrer, wesentlich älter und verheiratet, holte sie regelmässig mit dem Auto von der Schule ab. «Wir trafen uns immer heimlich, und wäre er nicht mein Lehrer gewesen, würde ich unsere Liaison heute als harmlose Freundschaft bezeichnen. Aber das war es nicht, weil ich ja erst vierzehn Jahre alt war und als Schülerin in einem Abhängigkeitsverhältnis.»
Als die geheimen Treffen aufflogen, schimpfte ihre Mutter heftig mit ihr. Ahlers schämte sich: «Ich hatte ja selber das Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben. Erst viel später ist mir klargeworden, dass nicht ich das Problem war.» Heute spreche sie darüber, «weil die Frauen sich jetzt wehren». Das Verhalten des Lehrers spielte für dessen Karriere keine Rolle: Er wurde später Schulleiter.
Auch Erika Kestenholz, pensioniert seit 2012, war Lehrerin. Die männlichen Kollegen hätten immer gerne mit den jungen Primarlehrerinnen geschäkert, sagt sie. «Zum Lachen gebracht haben sie uns oft. Man merkte, dass sie es gut haben wollten mit uns, vor allem die älteren Männer. Aber nie hätte ich mich deswegen unwohl gefühlt. Im Gegenteil.»
Hanspeter Bornhausers Arbeitsfelder waren Marketing und internationale Verhandlungen. Erst für Nestlé, später für Ciba Geigy oder Swissgas reiste er durch die Welt, arbeitete von Anfang an mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. «Die Herkunft war völlig egal, wenn der Mann die richtige Leistung brachte», sagt er. «Dass einer zum Beispiel dunkelhäutig ist, spielt erst heute eine Rolle.» Wichtiger war das Erscheinungsbild: Anzug, Krawatte, ordentliche Frisur. Damals habe man sich über Diskriminierung oder «Diversity» nicht den Kopf zerbrochen.
Auch das Wort «Burnout» habe man lange nicht gekannt, sagt der Gewerkschafter Scholl, aber Überbelastung und Depression habe es immer gegeben. «Nur sagte man da halt: Der Krug geht zum Brunnen, bis er bricht.» Heute dagegen werde früher die Reissleine gezogen. Aber vielleicht gebe es nicht nur mehr Arbeitsausfälle, weil die Leute besser auf ihre Gesundheit achteten, sondern auch, weil sie sie erst einmal auch stärker aufs Spiel setzten: Wer alle drei Jahre die Stelle wechsle, könne damit vielleicht seinen Lohn steigern, aber dafür fehle ein Arbeitsumfeld, in dem man verwurzelt sei und das einen stützen oder sogar auffangen könne.
Die Überstunden
Wie verhielt es sich mit der Work-Life-Balance? «Damit habe ich nie ein Problem gehabt», sagt Hans Weber, «ich habe einfach oft viel gearbeitet.» Sein Kollege Eggmann fand die Balance auf nicht ganz herkömmlichem Weg: An Sonntagen nahm er manchmal die ganze Familie mit ins Schulhaus: «Wir hatten in der Kanti einen Fernseher, das war Anfang der Siebziger für meine Kinder etwas Besonderes. Sie haben dann etwas geschaut, die Frau hat dazu gestrickt, und ich konnte im Labor die kommende Woche vorbereiten.»
Bei der neu gegründeten Kantonsschule Romanshorn gab es auch neben dem Unterricht viel zu tun. Eggmann etwa hatte Einsitz in der Baukommission, weil das eigentliche Schulhaus noch gar nicht stand. Kompensieren? Zusätzlich honoriert werden? Eggmann lacht. Aber damals habe es für ihn und seine Kollegen so gestimmt. «Ich habe meine Arbeit oft gar nicht als Arbeit empfunden», sagt er. Dass dann später die jüngeren Kollegen jede Sondertätigkeit auch speziell vergütet haben wollten, war Eggmann unangenehm. «Wenn man seine Arbeit mit Freude macht, schaut man nicht auf die Uhr.»
Der grosse Unterschied zu heute? «In den Ferien hatte ich Ruhe. Wir hatten kein Handy, auf dem man uns erreichen konnte», sagt Hans Weber. «Wenn wir weg waren, waren wir weg.»
Die Frauen
«Sie gehören bestimmt nicht hierhin», sagte ein junger Mann zu Gesche Ahlers, modisch gekleidet und vor allem – eine Frau. Die Altphilologie-Studentin Ahlers arbeitete damals oft bis spätabends in den Seminarräumen der Universität. «Meine Kommilitonen waren fast ausschliesslich Männer», sagt Ahlers. Das lag am Fach, und es lag an der Zeit. «Das war ja alles sehr männlich bestimmt damals. Es war schwierig für eine Frau», sie hält inne, «zumindest anders war es, anders als heute.»
Während in der Kaufmannsfamilie Ahlers darauf geachtet wurde, dass die drei Söhne eine solide kaufmännische Ausbildung erhielten, hiess es bei den Töchtern: «Lernt doch Krankenschwester. Ein Studium lohnt sich nicht, ihr heiratet ja bald und seid dann versorgt.» Ahlers lacht. 1962 hat sie in Deutschland Abitur gemacht. Danach ging sie an die Universität. «Und dann habe ich darum gekämpft, am Gymnasium eine Stelle als vollwertige Lehrerin zu bekommen.» Gegen sie verwendet wurde stets das gleiche Argument: Das lohne sich doch nicht, sie sei ja eine Frau, sie heirate doch bestimmt bald.
Von älteren Lehrern hatte Hans Weber gehört, warum Frauen früher regelmässig abgewimmelt wurden: «Noch bis Ende des 19. Jahrhunderts hiess es, Frauen seien nun einmal weniger intelligent und könnten darum die oberen Stufen gar nicht unterrichten. Auch seien sie besonders kompliziert und überdies noch Heulsusen.» Weber schüttelt den Kopf. Humbug, natürlich. Als Rektor habe er viel Wert darauf gelegt, Frauen ans Kollegium zu holen.
Ahlers hat irgendwann tatsächlich geheiratet. Doch ihr Mann verunglückte bald nach der Hochzeit: «Erst als Witwe habe ich dann eine richtige Anstellung am Gymnasium bekommen.» Damals war es vorgeschrieben, dass der Schulleiter seine Lehrkräfte vor deren Verbeamtung beurteilt. «Meine Probestunde lief gut, die Schüler haben lebhaft mitgearbeitet, aber der Herr Direktor hat davon nicht viel mitbekommen – er hat, inmitten der belustigten Schülerinnen und Schüler, geschlafen und sogar geschnarcht.» Die Note fiel für Ahlers dann aber enttäuschend aus. Ein Kollege sagte dann, daran müsse sie sich gewöhnen, «Frauen würden immer etwas schlechter bewertet».
Sie hätte kämpfen können, sagt Ahlers. Dagegen, dass es im Lehrerzimmer Tische gab, an denen sie als junge Lehrerin nicht sitzen durfte. Dafür, dass die Leistung von Frauen fair bewertet wurde. «Aber ich habe beschlossen, dass es für mich besser war, einfach sehr diplomatisch zu sein. Ich habe Entschuldigung gesagt – und dann gemacht, was ich wollte.»
Als die erste Frau in einen Beirat gewählt wurde, in dem auch Bornhauser sass, war er erstaunt: «Sie kam so burschikos daher. Und hat sich kumpelhaft gegeben, wie ein Mann. Ich fand das läppisch. Kumpel gab es ja genug, ihre Sonderstellung war doch gerade, dass sie eine Frau war.» Sonst aber sei die Beirätin nett und kompetent gewesen.
Alkoholprobleme, wie Bornhauser sie bei Männern immer mal wieder erlebt hat, gab es bei den Frauen nicht. «Die Frauen haben sich immer Mühe gegeben, das hat man gemerkt», sagt Bornhauser. Vielleicht, weil Frauen wussten, dass ihre Arbeitsstelle niemals gleich sicher ist wie jene ihrer männlichen Kollegen. «Im Studium sind von den Burschen viele gescheitert», erinnert sich Bornhauser, der in Bern Jura, in Paris Wirtschaft und in Harvard Marketing studiert hat. «Die Frauen sind ja grundsätzlich der ernsthaftere Teil der Menschheit. Die haben gelernt und alle Prüfungen bestanden.» Auch ein Studienplatz war für Frauen lange keine Selbstverständlichkeit. Wer an die Universität konnte, setzte diese Chance kaum leichtfertig aufs Spiel.
Der Rauch
Bornhauser sagt, er habe «geschlotet, überall: bei Sitzungen, im Flugzeug, immer». Schon damals habe es auch unter den Männern Nichtraucher gegeben. «Die haben während der Sitzungen schon etwas gelitten», sagt er. «Blödsinnig» sei das gewesen, wenn er es sich jetzt – seit zwanzig Jahren dem Rauchen entwöhnt – so überlege.
Die stinkenden Anzüge habe seine Frau zu Hause gereinigt, und wenn sich beim Duschen der Zigarettenrauch von Haut und Haaren gelöst habe, dann fand er es auch selber eklig. Aber was soll man machen – es war halt eine andere Zeit.
Die Jungen
Als der Gewerkschafter Scholl Ende der sechziger Jahre in Biel mit seiner Lehre als Chemielaborant begann, seien die Sitten noch härter gewesen, «da flogen auch mal Hämmer. Und derbe Sprüche.» Wenn man im ersten Lehrjahr vor allem Kaffee kochen musste und ab dem zweiten als billige Arbeitskraft missbraucht wurde, dann war das halt so. «Das kam ja nie raus – das Internet, wo man solche Dinge heute publik machen kann, gab es nicht.»
Migros-Verkäuferin Esther Fanger (Jahrgang 1956) arbeitete gerne mit jüngeren Kollegen. Dann hat sie beobachtet, wie anders die Dinge heute laufen. «Die Jungen sind empfindlicher geworden. Die bleiben heute wegen Kopfweh daheim. Manchmal würde ich gerne sagen: ‹Nimm doch einfach ein Aspirin›, aber ich weiss, dass man das nicht darf.» Früher hätten die Leute mehr vertragen, auch zwischenmenschlich. Heute wisse man ja kaum noch, was zu sagen erlaubt sei.
«Die Lernenden heute erscheinen mir weniger belastbar. Bei uns hiess es einfach: ‹Mach das›, und man machte es», sagt die Floristin Christine Baams (Jahrgang 1957). Das liege vielleicht daran, dass die Jungen sich heute wehren könnten. Sie hätte sich nie getraut, dem Lehrmeister zu widersprechen. Allerdings sei die Arbeitswelt rauer geworden, die Jungen hätten es schwerer. «Als ich aus der Schule kam, ging es wirtschaftlich aufwärts. Immer nur aufwärts. Ich bekam immer mehr Lohn, der Wohlstand nahm stetig zu. Das hat mich geprägt.»
Einer der Jungen habe zu Fanger kürzlich gesagt, er arbeite nur 80 Prozent, nur für so viel Geld, wie er brauche. «Und ich dachte: Recht hat er!» Wozu sich aufopfern? «Ich ging früher lieber arbeiten», sagt Fanger. Baams überlegt, dann sagt sie: «Heute wissen die jungen Leute schon früh, was sie als Mensch wert sind.» Das sei vielleicht der grösste Fortschritt der letzten fünfzig Jahre.